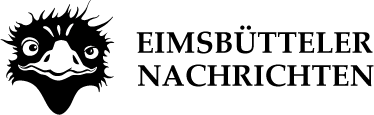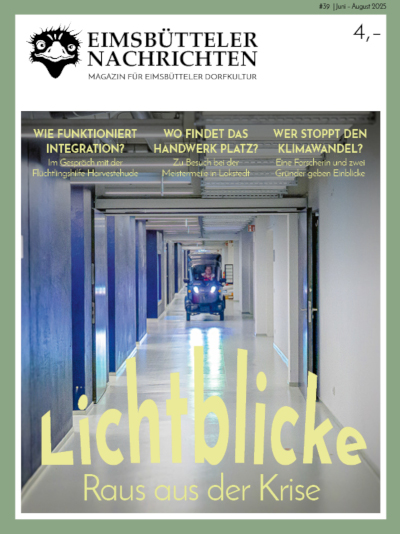„Ich kann was“
Eimsbüttel im Jahr 1983: Ein wirtschaftlicher Aufschwung beginnt, die Tagesschau spricht von landesweit guten Wachstumsraten. Die Zahl der Erwerbstätigen beginnt langsam wieder zu steigen. In Stellingen wird der Hamburger Sportverein nach hervorragender Arbeit Deutscher Fußballmeister und das Wort des Jahres wird später „Heißer Herbst“ lauten. Auch Windkraft und Aids produzieren Schlagzeilen. Persönliche Arbeitslosenschicksale dagegen weniger.
Von GastInnerhalb dieser Koordinaten, zwischen den politischen Ausläufern des Kalten Krieges und einer inhaltlich brennenden Atomkraftbewegung in der BRD lebt der Lehramt-Student Werner K.* mit seiner Partnerin Petra in einer Altbauwohnung im Herzen Eimsbüttels. Das Leben empfinden beide als geruhsamen Fluss, selbst die Nachrichtensprecher um 20 Uhr im Fernsehen strahlen zu dieser Zeit eine wohltuende Ruhe aus. Die Wohnung ist ein Nest. Warm und beschützt, beherbergt sie eine gut aufgehobene junge Familie in Gründung. Die Träume sind bunt und umfangreich. Trotz warnender Botschaften aus dem Freundeskreis, denn die Arbeitslosigkeit unter Lehrern ist hoch zu Beginn der Achtziger. Ein Kind ist bereits geboren, ein zweites auf dem Weg. Die Festanstellung als Deutschlehrer an einer Schule dagegen nicht in greifbarer Nähe. Auswärtiges Essen gehen beim internationalen Nachbarn nebenan ist etwas Besonderes und wird sich „verkniffen“. Der Radius im Stadtteil ist eher klein, die ersehnte Perspektive trotz allem groß: Familie, ein eigenes Haus, die generalisierte Harmonie. Im Schutz des Altbaus entstehen aber zur selben Zeit erste Risse: Werner K. muss sich nach dem Referendariat arbeitslos melden. Eine Zäsur.
Niemand hat die Absicht
Die Reaktionen im Freundeskreis folgen mit Verzögerung, aber nagen umso mehr. K. wird öfters hinterfragt. Ob es verantwortungsbewusst sei, einen Beruf zu wählen, der doch ganz offensichtlich überlaufen ist. Diese Auseinandersetzungen finden auf persönlicher Ebene statt. Direkter, intensiver, nachhaltiger nimmt K. wahr, wie seine Umwelt auf das mutmaßliche Scheitern zu reagieren beginnt. Telefonate sind 1983 noch bewusst gesteuerte und gewollte, oft sogar zeitlich verabredete Dialoge ohne Kurzwahl. Kein unbedachter oder hektischer Facebook-Kommentar. Getauscht wird oft in der härtesten Kommunikationswährung: Im direkten Gegenüberstehen. „Warum bekommst du eigentlich einen Job und ich nicht“, stellt Werner K. sich bald immer wieder dieselbe Frage. Er formuliert sie gegenüber sich selbst, durch die Filter seiner subjektiven Sinne für globale Gerechtigkeit. Ängste vor sozialem Abstieg melden sich zu Wort. „Ausgrenzung“ macht die Runde in seiner zunehmend verhärteten Seele. Die innerdeutsche graue Mauer aus den täglichen Nachrichten ist noch fest betoniert. Niemand hat die Absicht, eine Mauer um Werner K. zu errichten. Dafür sorgt K. von Tag zu Tag schon sachte selbst. Derweil die junge Familie anfangs mit ungefähr einem Drittel weniger Einkünften auskommen muss, erlebt K. die Termine beim Arbeitsamt und beim Beantragen von Sozialhilfe als vergleichsweise wenig Druck ausübendes, notwendiges Übel. Auch im vertrauten Heim erlebt er Verständnis und Geduldversprechen.
Begegnungen und Symbole
Auf dem Spielplatz sitzen einige ihm bekannte und fremde Eltern. Viele schauen herüber und grüßen freundlich. Den eigenen Kinderwagen der Tochter empfinden Werner und Petra K. schon bald als hässlichen Ballast. Nicht eines schreienden Kindes wegen. Gebraucht und günstig gekauft verrichtet das „soziale Statussymbol“ zuverlässig seinen Dienst. Nur strahlt sein zweckmäßiges Design …
Du willst wissen, wie es weitergeht? In unserer Sonderausgabe #3 Arbeiten kannst du die ganze Geschichte lesen. Erhältlich ist das Magazin seit 31. März am Kiosk oder gleich hier online.
Noch mehr Leseproben: „Pretty Woman“ und „Ferien für immer?“
Text: Michael Kellenbenz