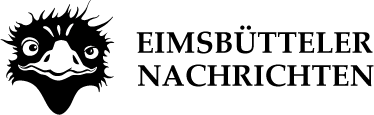Wie ich zur Stammtischkämpferin wurde
Unsere Autorin Alexis hat einen Workshop besucht, um zu lernen, sich gegen Stammtischparolen durchzusetzen.
Von Alexis MilneMit 18 Jahren habe ich mich zum ersten Mal so richtig verbal in die Ecke gedrängt gefühlt. Mein Onkel und seine Frau hatten sich in den Kopf gesetzt, mich über die Diskriminierung von queeren Menschen zu belehren: Wir seien selbst schuld, würden uns mit Pride-Veranstaltungen und selbst auferlegten Labels von der „normalen Gesellschaft” abgrenzen. Damals wusste ich nicht, wie ich reagieren sollte. Ich wollte dagegenhalten – war aber überrumpelt. Auch heute, Jahre später, ärgere ich mich darüber.
Worum geht es?
Inzwischen gibt es für fast alles einen Workshop. Die einen bemalen Keramik, die anderen gurgeln Wein. Ich habe entschieden zu lernen, wie ich mich in Stammtischdiskussionen durchsetze. Ich bin zwar nicht Teil eines Stammtisches, mich gegen leere Parolen behaupten können, möchte ich aber trotzdem. Also, worum geht es dabei? Soll ich lernen, wie ich Personen richtig anmeckere? Lerne ich jetzt „die richtigen” Zahlen und Fakten?
Der Workshop
Mit 25 weiteren Teilnehmerinnen und Teilnehmern sitze ich in der Kinderbibliothek der Bücherhalle Eimsbüttel. Ein drolliger Ort für ernste Themen; wir kontern Neonazi-Parolen irgendwo zwischen dem „Kleinen Prinzen” und „Mama Muh”. Der Workshop findet im Rahmen der „Wochen gegen Rassismus” statt und wird vom Verein „Aufstehen gegen Rassismus” organisiert. Dabei leiten uns Babette und Georg vom Verein mit Übungen und kurzen Vorträgen an.
Nach fünf, vielleicht zehn Minuten lichtet sich der Workshop-Schleier. Ich bin nicht hier, um Zahlen und Argumente auswendig zu lernen. Ich muss auch nicht Stammtischmitglied werden. Ich lerne heute, Diskriminierung zu erkennen, sie anzusprechen und verbal dagegenzuhalten. Es geht um Rassismus, Sexismus und Homophobie. Unser Ziel: Keine diskriminierende Aussage soll unwidersprochen bleiben.
Debatten sind für mich schwierig
Als Kind und Jugendliche habe ich Konflikte am liebsten gemieden. Mit 17 oder 18 Jahren führte kein Weg mehr drumherum: Themen wie die „Flüchtlingskrise” und die AfD wurden unumgänglich. Nach meinem Coming-out wurde ich plötzlich selbst zum Thema. Heute, gut sieben Jahre später, halte ich mich für relativ fit in Diskussionen. Ich muss es sein, denn es geht immer wieder um meine eigenen Rechte.
Das Wissen, die Argumente und die Rhetorik sitzen bei vielen Themen, halbwegs. Trotzdem werde ich schnell nervös, steigere mich rein, bekomme Angst, mich zu verhaspeln – und verhaspele mich. Meine Intention für den Workshop ist vor allem zu lernen, einen kühlen Kopf zu bewahren.
„Pick your battles“
Um das vorwegzunehmen: Es macht einen riesigen Unterschied, in welchem Rahmen eine Diskussion stattfindet. Alleine auf der Straße? Oder am Tisch mit Familie, Freunden oder Bekannten? Weil die eigene Sicherheit Priorität hat, ist es wichtig zu erkennen, wann eine Diskussion wirklich Sinn ergibt. Eine pöbelnde, besoffene Männergruppe auf der Straße ist nicht unbedingt auf eine zivilisierte Debatte aus. Pick your battles.
Werden fremde Menschen in der Öffentlichkeit angegangen, sollte man nicht einfach in den Streit springen, sagen Babette und Georg. Besser sei es, die betroffene Person direkt anzusprechen: „Geht’s dir gut? Stört dich diese Person?” Dann kann es, mit Zustimmung, weitergehen. In Debatten sei es gut, Gefühle anzusprechen, sagen unsere Workshop-Leiter. Zum Beispiel: „Was du gerade gesagt hast, macht mich richtig sauer.” Oder um einen Schluss zu finden: „Ich möchte da nicht weiter drüber reden.”
Drei mögliche Muster in Argumenten
Im Workshop geht es nicht um Zahlen, sondern um die Strukturen dahinter. Babette und Georg erzählen uns beispielhaft von drei möglichen Mustern in Argumenten. Natürlich gibt es mehr.
- Der Einzellfall: „Meine muslimischen Nachbarn erlauben es ihrer Tochter nicht, beim Schwimmunterricht teilzunehmen.” Zunächst kann bei diesem Beispiel explizit angesprochen werden, dass das ein Einzelfall ist und keinen Rückschluss auf den Islam als Religion oder Muslime als Personengruppe rechtfertigt. Gut kann auch ein Gegenstatement wirken. Zum Beispiel: „Mein christlicher Nachbar hat seine Katze umgebracht.” Sind deshalb alle Christinnen und Christen Katzenmörder? Wohl kaum.
- Der Parolen-Flickenteppich: Der Flickenteppich ist eine lose Aneinanderreihung von Kampfbegriffen und Parolen, oft ohne Substanz. Ein Beispiel: „Homosexualität ist unnatürlich, eine mentale Krankheit und Sünde. Die sind eine Gefahr für unsere Kinder, außerdem zerstören sie das richtige, traditionelle, natürliche Familienbild.” Bei so einem Schwall an „Argumenten” raten Babette und Georg, das Muster zu unterbrechen, einen der Punkte in den Fokus zu nehmen und zu widerlegen – am besten einen, mit dem man sich gut auskennt – oder Gegenfragen zu stellen: „Aber was sagst du denn dazu, dass auch bei vielen Tierarten gleichgeschlechtliche Partnerschaften dokumentiert wurden?”
- Political Correctness: Das sind Argumente à la „heutzutage darf man ja gar nichts mehr sagen”. Die Antwort kann lauten, dass man tatsächlich (fast) alles sagen darf, man sollte nur bereit sein, für die eigenen Worte auch die Verantwortung zu tragen und mit Gegenwind klarzukommen.
Es lohnt sich
Nach dem Input haben wir das Gelernte angewendet. Dafür haben alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer eine Aussage bekommen – meine lautete: „Zieh dir doch mal einen Rock oder ein Kleid an. Das sieht viel schöner aus und gefällt auch den Kunden.” Wir haben uns immer wieder mit anderen Personen in Paaren zusammengefunden und jeweils unsere Parolen diskutiert. Eine gute Übung, finde ich. Wir mussten schnell auf die Position des Gegenübers reagieren und waren gezwungen, ohne langes Überlegen den Kern der Aussagen zu finden und effektiv zu argumentieren. Keine Zeit fürs Überrumpeltwerden oder Verhaspeln.
Nach dem Workshop fühle ich mich sicherer in meinen Argumenten, etwas ruhiger im Diskussionsgespräch. Ich frage mich, warum so etwas nicht allen Menschen nahegebracht wird. Am besten in der Schule. Debatten und Diskussionen sind wichtig für unsere Demokratie. Wir sollten alle Verbündete für die Minderheiten unserer Gesellschaft sein, denke ich. Dass wir 26 Workshop-Teilnehmer das alle so fühlen und leben, baut mich auf, spendet Mut. Aber gleichzeitig bedrückt es mich. Ist es nicht krank, dass wir solche Workshops brauchen? Eine Sache, die Babette gesagt hat, geht mir nicht aus dem Kopf: „Die haben den leichten Job.” Es stimmt, die Demokratie zu gefährden, Fehlinformation zu verbreiten, Menschen zu beleidigen, ist leicht. Dagegen anzugehen erfordert Kraft, Energie, Zeit und Mut. Aber es lohnt sich.
lokal. unabhängig. unbestechlich.
Eimsbüttel+

Mit Eimsbüttel+ hast du Zugriff auf alle Plus-Inhalte der Eimsbütteler Nachrichten. Zudem erhältst du exklusive Angebote, Deals und Rabatte von unseren Partnern.