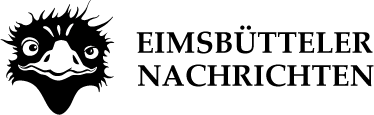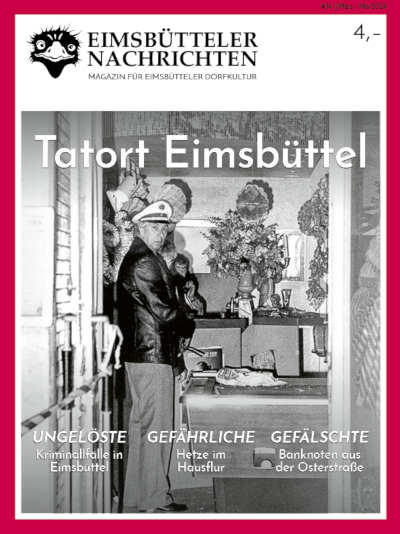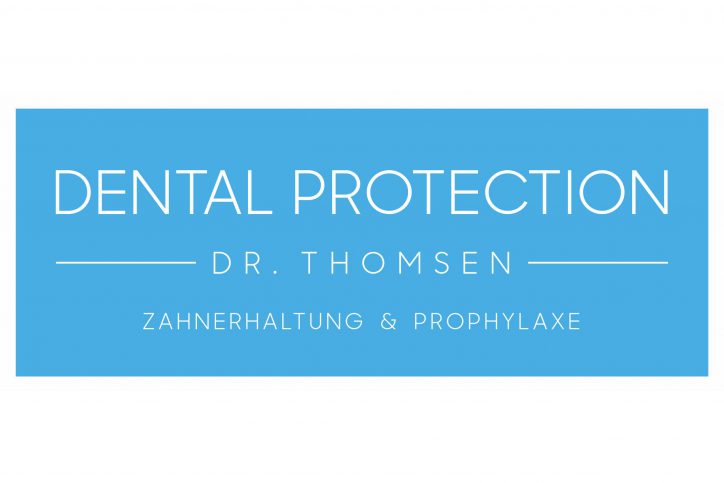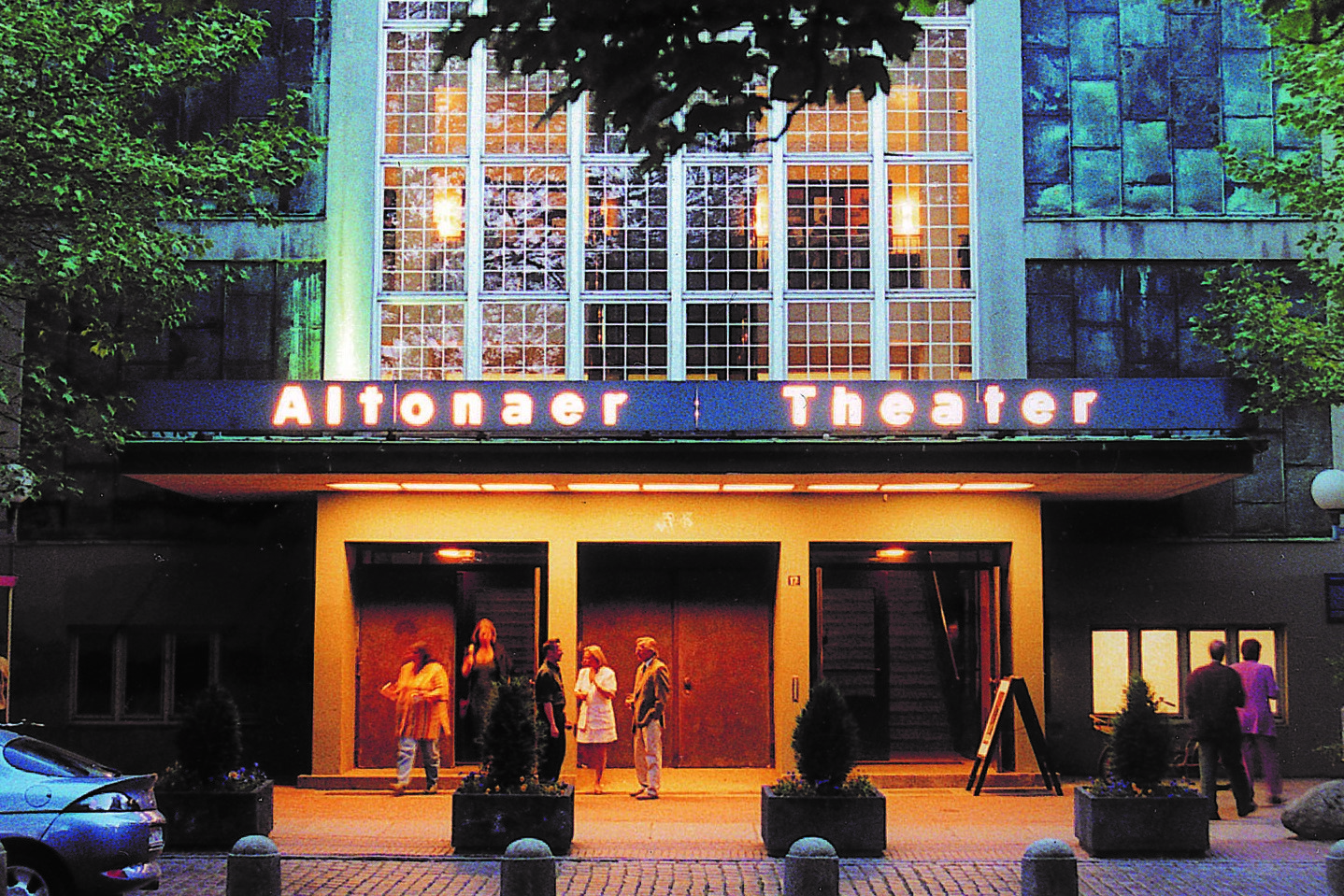Ein Luftschloss im Kongo
Das Krankenhaus der Stadt Baraka ist ein Lager aus Hütten, in dem sich drei Kinder ein Bett teilen. Ein neues soll das ändern – das größte im Ostkongo soll es werden. Eimsbütteler Robert Kösch hilft beim Bau. Die Rekonstruktion einer unmöglichen Mission.
Von Vanessa LeitschuhNimm dir eine Karte der Demokratischen Republik Kongo und klebe sie auf eine Dartscheibe. Nun nimm einen Pfeil und wirf. Dort, wo der Pfeil einschlägt, soll ein Krankenhaus entstehen. Du musst nicht besonders gut zielen, dein Pfeil wird überall gebraucht. Du wirfst und – das war knapp. Fast wäre er im Tanganjikasee gelandet. Aber du hast Glück, er steckt am Ufer des Sees in der Stadt Baraka.
Baraka ist die größte Stadt im Gebiet Fizi, ganz im Osten des Landes. Auf der anderen Seite des Tanganjikasees, des zweitgrößten Sees in Afrika, liegen Burundi und Tansania. Um Baraka zu malen, braucht es eigentlich nur drei Farben: das Rostrot der Erde, das Sattgrün der Mangobäume, das Tiefblau des Himmels. Du siehst Frauen mit Kanistern an einem Brunnen warten. Du riechst Feuer, das am Straßenrand züngelt und Plastikmüll frisst. Du hörst Ziegen blöken, Motorräder knattern, Kinder lachen.
Bis vor einigen Jahren war Baraka auf keiner Landkarte zu finden, obwohl hier etwa 150.000 Menschen leben. Steinhäuser, Lehmhütten, Sandpisten, aber keine asphaltierte Straße, kein Verkehrsschild, kein Stromkasten, kein Wasserhahn. Die Menschen leben in Hütten, die jeden Tag vom Regen weggespült werden können. Rebellen sind in der Region aktiv, kämpfen um die wertvollen Bodenschätze. Immer wieder kommt es zu Überfällen, Vergewaltigungen werden als Kriegswaffe eingesetzt. Auf Swahili bedeutet Baraka Segen.
Es sind Orte wie diese, die als erste durch das Netz eines maroden Gesundheitssystems fallen. Baraka liegt in einer Malaria-Region. Seit 2003 kämpft Ärzte ohne Grenzen hier gegen Krankheiten wie Masern, Tuberkulose oder Cholera. In einem Krankenhaus, das einmal ein Kloster war. Zwischen den einstöckigen Häusern wurden Hütten gebaut, um mehr Patienten unterzubringen. Im Hof spannt sich ein Netz aus Seilen, auf denen Wäsche trocknet. Es gibt kein Röntgengerät, keine Küche – das Essen wird von den Familien der Patienten zubereitet. Auf der Station für mangelernährte Kinder sind alle Betten belegt, stehen dicht an dicht, in manchen liegen drei Kinder gleichzeitig.
Der Bau eines neuen Krankenhauses soll das ändern. Auf einer Fläche so groß wie elf Fußballfelder soll es das größte im Ostkongo werden. Ärzte ohne Grenzen hat dafür in Baraka einen Stützpunkt eingerichtet. Dort sollen Bauleiter, Architektinnen und Hygieneexperten aus aller Welt unterkommen. Ende 2019 suchen sie einen Logistiker, der das Projekt vor Ort betreut.
I. Der Logistiker
Robert Kösch glitt über die Dünen der dänischen Küste. Unter ihm seine Freunde, dunkle Punkte im weißen Sand. Es war März, der Wind in Esbjerg wehte stark. Plötzlich erfasste ein Windstoß seinen Gleitschirm, warf ihn meterweit zurück, er verlor die Kontrolle.
Beim Aufprall auf die Düne brach seine Rippe an, bohrte sich ins Lungenfell, bis der linke Lungenflügel wie ein Luftballon mit Loch in sich zusammenfiel.
Zwanzig Minuten später lag Kösch auf dem Operationstisch. Chirurgen versuchten, mit feinen Instrumenten das Loch zu schließen. Als er aufwachte, stand sein Arzt vor ihm: „Herr Kösch, Sie hätten tot sein können.” Der Satz überrollte den 26-Jährigen, traf ihn wie ein zweiter Aufprall. Von da an tauchte die Frage in ihm auf: Wie sinnvoll hat er die letzten Jahre genutzt?
Eimsbüttel ist Robert Köschs Wahlheimat. Aufgewachsen ist er in Mainz, aber verwurzelt ist er hier. Seit sieben Jahren lebt er in Hamburg, mittlerweile mit seiner Frau. Aber der Unfall hat etwas verändert, hat alles zum Stillstand und dann ins Rollen gebracht. Er hat gespürt, welchen Schatz wir mit unserem Gesundheitssystem hüten und wie selbstverständlich gute medizinische Versorgung hier ist. Er wollte etwas verändern, etwas tun, das den Menschen direkt nützt – und bewarb sich bei Ärzte ohne Grenzen.
Zehn Monate nach dem Unfall feierte Kösch seinen Abschied in der Eimsbütteler Q-Bar und verließ Hamburg in Richtung Demokratische Republik Kongo. Er ist kein Arzt, sondern Projektmanager bei Airbus, aber auch die werden für ein Projekt wie den Bau eines Krankenhauses gebraucht. Als First Missioner, ohne Erfahrung in einer NGO, sollte er sich ein Jahr lang in Baraka um Logistik, Personal und Finanzen kümmern.
“Was bedeutet dieses ominöse Helfen?”, fragt Robert Kösch, als er ein Jahr danach in einem Eimsbütteler Café sitzt und die Monate im Kongo rekonstruiert. Es ist September 2021, noch ist es warm, noch stehen die Tische vor dem Café May im Freien. Gerade ist sein Buch über seine Erlebnisse im Kongo erschienen. Während er redet, rutscht ihm immer wieder die Brille von der Nasenwurzel. Lange erzählt er vom Krankenhausprojekt. Dabei wirken seine Worte wie auf Draht gezogen, sie folgen immer einer Logik, nie verliert er sich in Nebensträngen. „So gut unsere Motive auch waren, wir waren eine Kraft von außen.”
Es ist ein einfaches Versprechen, dem sich Ärzte ohne Grenzen verschrieben hat und das Robert Kösch zu seiner Mission führte: medizinische Hilfe zu leisten, wo sie dringend gebraucht wird. Aber die Wirklichkeit dahinter ist komplexer. Denn Entwicklungsprojekte wie der Bau eines Krankenhauses bergen Risiken, schaffen Abhängigkeiten oder können den lokalen Markt aus dem Gleichgewicht bringen.
II. Im Kongo
Zerrissene Taue liegen wie tote Schlangen am Strand. Plastik schmort in der Sonne. Das Wasser leckt am Ufer, als greife es nach nackten Füßen. Wasser bedeutet Leben. Hier am Ufer des Tanganjikasees bedeutet es Gefahr. Parasiten tummeln sich darin, lauern auf Fußsohlen, in die sie sich bohren, auf Körper, in die sie Eier legen, auf Lebern und Venen, die sie befallen können. Ein Boot von Ärzte ohne Grenzen schaukelt nahe am Ufer. Die Ärztinnen und Helfer balancieren über Steine zum Boot, darauf bedacht, das Wasser zu meiden. Um sie herum toben Kinder im See.
Im Januar 2020 ist Robert Kösch in Baraka in der Provinz Süd-Kivu angekommen. Die nächste größere Stadt, Bukavu, ist vier Stunden mit dem Geländewagen entfernt. In Baraka gibt es zwei Stützpunkte von Ärzte ohne Grenzen. Der erste besteht seit 2003. Von dort aus betreuen sie das bestehende Krankenhaus, ein Malaria-Camp und ein Cholera-Zentrum. Kösch wohnt in der neuen Basis, von wo aus sie das Bauprojekt leiten. Ein ehemaliges Hotel, das sie Papaya nennen, 800 Quadratmeter, umgeben von Mauern und Stacheldraht.
An diesem Tag haben sie frei, es ist Sonntag, die Sonne brennt auf den Tanganjikasee. Eine der Ärztinnen geht zu den Frauen am Ufer, die Wasser in Kanister füllen und deren Kinder dort spielen. Sie versucht ihnen zu erklären, welche Gefahren im Wasser lauern und was Bilharziose im Körper eines Menschen anrichten kann. Die Frauen schöpfen weiter.
Der Zugang zu sauberem Wasser ist ein Problem in der Demokratischen Republik Kongo. Die Gesundheitsaufklärung auch. Traditionelle Heiler wenden teils fragwürdige Methoden an. Als Kösch ein Gesundheitszentrum außerhalb von Baraka besucht, trägt ein Vater seinen schreienden Sohn durch den Eingang. Das Bein des Jungen ist aufgerissen, der Knochen zu sehen. Ein Heiler hat die Wunde mit Zigarettenstummeln behandelt.
Auch Krankheiten wie Masern, Tuberkulose oder Cholera sind im Kongo verbreitet, obwohl es für sie eigentlich Heilmittel gibt. Doch das kongolesische Gesundheitssystem ist dem nicht gewachsen. Laut Weltbank gibt kein Land weniger für die Gesundheit seiner Einwohner aus: 18,5 US-Dollar pro Kopf waren es im Jahr 2018 – in Deutschland waren die Ausgaben 300 Mal so hoch. Und je ländlicher die Gebiete, desto überforderter die Kliniken im Kongo.
Beim Bau des Krankenhauses, dem größten Infrastrukturprojekt in der Region, muss Ärzte ohne Grenzen mit Fingerspitzengefühl vorgehen. Denn ein solches Projekt könnte den lokalen Markt durcheinander bringen und Materialpreise in die Höhe schießen lassen. In den vergangenen Monaten haben sie um Genehmigungen gekämpft. Jetzt ist die Machbarkeitsstudie abgeschlossen, die Ausschreibungen laufen, bald sollen die Bagger anrollen.
Aber es kommt anders. So wie es im März 2020 überall auf der Welt anders gekommen ist.
IV. Gebrochene Versprechen
Die Grenzen waren dicht. Robert Kösch starrt auf sein Handy. Morgen sollte er seine Frau wiedersehen, ein Urlaub von der Arbeit in Baraka, drei gemeinsame Wochen in Südafrika, bevor der Krankenhausbau begann. Nun hat der südafrikanische Präsident die Grenze geschlossen, auch die Außengrenzen der EU waren zu.
Muzungu, Muzungu riefen die Kinder, wenn sie Robert Kösch auf der Straße sahen. Muzungu, der Weiße im Kongo. Jetzt zeigten sie mit dem Finger auf ihn und riefen Corona, Corona, nach der Krankheit der Weißen.
Ein neues Virus, in einem Land, das mit Viren wie Ebola und Masern kämpft, dessen Gesundheitssystem auch ohne Pandemie an seine Grenzen stößt. Am 19. März 2020 meldet die kongolesische Wirtschaftszeitung Zoom Eco, dass in der Demokratischen Republik Kongo insgesamt 50 Beatmungsgeräte zur Verfügung stehen – für rund 90 Millionen Einwohner. Ärzte ohne Grenzen beschließt, den Bau des Krankenhauses vorerst zu stoppen: Der Kampf gegen Corona hat Vorrang.
“Ein Schlag ins Gesicht”, sagt Robert Kösch. Sie haben viel getan, um die Menschen vor Ort auf das neue Krankenhaus vorzubereiten. Manche haben ihr Land hergegeben. Und jetzt stoppte die Organisation den Bau.
Die Einwohner in Baraka waren schon oft von der Politik enttäuscht worden: Ein internationaler Flughafen, ein Fußballstadion, ein Kraftwerk, asphaltierte Straßen waren ihnen versprochen worden. Nichts davon wurde umgesetzt. Das Vertrauen in die Regierung war aufgebraucht. Dann versprach Ärzte ohne Grenzen ein neues Krankenhaus. Wieder nur ein leeres Versprechen?
Robert Kösch sitzt mit sechs Kollegen der Hilfsorganisation im Besprechungsraum von Papaya. Statt eines Krankenhauses planen sie jetzt ein Notfallzentrum für Corona-Kranke. Sie stricken an einer Strategie, wie sie die bestehende Klinik vor dem Virus schützen und die Menschen vor Ort aufklären können.
Sie beschließen, mit den örtlichen Schulleitern zu sprechen. Die Schulen sind geschlossen, die Gebäude stehen leer – warum nicht hier das Corona-Zentrum einrichten? Kösch und sein Chef besuchen eine Schule in der Nähe des alten Krankenhauses. Sie betreten ein Klassenzimmer. Auf dem Boden wabert eine Suppe aus Schlamm. In den Balken nisten Vögel. Dazwischen hängt der Geruch von Moder. Tische und Stühle stehen durcheinander. Es gibt keinen Strom, kein fließendes Wasser. Bald soll hier ein steriler Raum entstehen.
Das Team arbeitet von früh bis spät, sechs Tage die Woche. Köschs Chef ist jetzt mehr Politiker als Bauingenieur. Termin um Termin spricht er sich mit Bürgermeister, Militär und dem örtlichen Gesundheitswesen ab.
In Papaya werden keine Feste mehr gefeiert. Aus den Nachbarprojekten brechen die ersten Helfer ihren Einsatz ab, kehren zu ihren Familien zurück. Hilfsorganisationen konnten ihre Mitarbeiter nach Hause fliegen, aber es durfte kein neues Personal nachkommen. Das Leben in Baraka veränderte sich, es wurde dumpfer und stiller.
IV. Draußen im Busch
Unweit des Tanganjikasees zieht sich eine einzelne Straße, nein, eine Sandpiste durch das Land. Mitten auf dieser Piste, zwischen dem Dorf Malinde und der Stadt Baraka, zwei weiße Punkte auf rotem Sand. Geländewagen mit der Aufschrift “Medecins Sans Frontieres” – Ärzte ohne Grenzen. Sie sind verlassen, die Türen stehen offen. Im linken Rückspiegel ein Einschussloch. Eine Entführung. Schon wieder.
Ihre Kollegen wurden verschleppt. Sie sind jetzt da draußen im Busch.
Kein Mitarbeiter von Ärzte ohne Grenzen trägt eine Waffe, nicht einmal die Wächter der Stützpunkte. Aufkleber mit durchgestrichenen Gewehren auf den Geländewagen zeigen das auch unterwegs. Die Strategie der Organisation, um im Einsatz sicher zu sein: Gut mit der Bevölkerung auskommen. Den Konfliktparteien vor Ort vermitteln, dass sie eine unabhängige, neutrale Organisation zwischen den Fronten sind, kein Feindbild, das es anzugreifen gilt. Meist wird das toleriert. Nicht immer. Vor allem, wenn die Angriffe nicht politisch motiviert, sondern krimineller Natur sind, wird es schwieriger.
Auf ein Sonderkommando der Polizei können die Entwicklungshelfer nicht hoffen, vielmehr befürchten sie ein Kreuzfeuer zwischen Entführern und Militär. Sie stellen selbst ein Krisenteam zusammen. Robert Kösch und sein Chef stehen in ständigem Kontakt mit der Koordination in Bukavu. Bis tief in die Nacht suchen sie nach Informationen. Statt einer anrollenden Pandemie bekämpfen sie jetzt Entführer.
Nach Tagen der Unsicherheit sollen ihre Kollegen freigelassen werden. Wie genau sie das erreicht haben, darüber schweigt Ärzte ohne Grenzen. Kösch und sein Chef sitzen im Funkraum, von wo aus sie den Einsatz steuern. Sie schicken eine Kolonne von Geländewagen in den Busch, sie sollen die Entführten zurück zur Basis bringen. Warten. Dann krächzt das Funkgerät: “On est ensemble! Wir sind zusammen, wir haben unsere Freunde!”
Die Anspannung entlädt sich, als der Wagen durch das Tor des Stützpunktes fährt. Gebastelte Willkommensplakate begrüßen die Heimkehrer. Sie steigen aus dem Auto. Jubel. Umarmungen. Lachen. Tränen.
V. Bedroht
Die Pandemie rollt weiter auf die Region zu. Der Frust über den Baustopp und die Angst vor dem Virus sind die Glut, die die Stimmung in der Stadt wie in einem Feuertopf zum Kochen bringt.
Die Sicherheitslage für die Helfer verschlechtert sich. Sie werden zur Zielscheibe von Verschwörungstheorien: „Ärzte ohne Grenzen will einen Impfstoff testen, und wir sind die Versuchskaninchen”, heißt es. Andere vermuten, die Organisation habe das Virus absichtlich eingeschleppt, um zusätzliche Spenden einzustreichen.
Köschs Chef fühlt sich in Baraka nicht mehr wohl. Sein Entschluss: Er bricht die Mission ab, fliegt zurück nach Montreal, nach Hause. Plötzlich trägt Kösch die Verantwortung für Projekt und Mitarbeiter, muss sich mit Bürgermeister, Behörden und Militär über Corona-Maßnahmen abstimmen. Eine Katastrophenbesprechung folgt der nächsten. Dann landet ein Brief auf seinem Schreibtisch. “Wenn ihr die Zelte nicht innerhalb von 72 Stunden abbaut, brennen wir sie ab.” In den Zelten vor dem Krankenhaus messen sie Fieber, um Corona-Kranke zu identifizieren. Kösch versucht, die Konfliktparteien an einen Tisch zu bringen. Er verhandelt lange, um Krankenhauspersonal und Patienten zu schützen. Trotz allem macht das Team weiter.
Doch dann: die dritte Entführung innerhalb weniger Monate. Damit haben sie die Linie übertreten, auf die sie seit Monaten zusteuerten.
Ärzte ohne Grenzen zieht die Mitarbeiter aus Baraka ab. Die Organisation will die Entwicklung beobachten und beide Projekte in Baraka für drei Monate einstellen – sowohl den Bau des neuen Krankenhauses als auch die Betreuung des alten.
Der Neubau – gestoppt. Das Corona-Zentrum – geschlossen. Alles, was sie aufgebaut haben – eingerissen. Rund 170 kongolesische Frauen und Männer haben für die beiden Stützpunkte in Baraka gearbeitet. Viele von ihnen werden nun ihre Arbeit verlieren. Der Leiter des alten Krankenhauses ist fassungslos: „Ihr geht, aber die Probleme bleiben hier.”
Robert Kösch und ein Kollege sind die letzten der NGO, die Baraka verlassen. Sie steigen in den Flieger, die LET L-410 beschleunigt auf der buckligen Startbahn, dann heben sie ab. Die Plantagen und die Sandpiste werden kleiner. Über allem hängt eine Staubglocke. „Und dann fliegt man über die Stadt, zurück nach Europa, ins goldene Land, und für meine kongolesischen Mitarbeiter bleibt das Leben hart – und wird härter, weil sie alle ihren Job verloren haben.”
Am 14. August 2020, so berichtete die Lokalzeitung Kivu Times, zogen die Bewohner von Baraka durch die Straßen der Stadt und verlangten die Rückkehr von Ärzte ohne Grenzen. Sie forderten die Verurteilung derjenigen, die ihre Stadt durch die Entführungen in Unsicherheit gestürzt haben.
Am 1. Dezember 2020 veröffentlicht Ärzte ohne Grenzen eine Pressemitteilung mit dem endgültigen Entschluss: „Wir haben uns diese Entscheidung nicht leicht gemacht”, schreibt Einsatzleiterin Ellen van der Velden. „Aber nach mehreren Sicherheitsvorfällen gegen unsere Mitarbeiter im Fizi-Gebiet ist eine Schwelle erreicht, die wir nicht mehr akzeptieren können.” Das Krankenhaus wird nie gebaut werden, Ärzte ohne Grenzen wird nicht nach Baraka zurückkehren.
VI. Zurück in Deutschland
Robert Kösch sitzt in seiner Wohnung in Eimsbüttel, gerade hat er das erste Türchen seines Adventskalenders geöffnet, als ihn die WhatsApp-Nachricht einer Kollegin erreicht. Ein Link zur Pressemitteilung, ohne Kommentar. Kein Krankenhaus im Kongo. Die Mission ist gescheitert, das Versprechen gebrochen, das Projekt in sich zusammengefallen wie ein Luftballon mit Loch.
Was bleibt? Ein Koffer voller guter Taten? Ein Notizbuch voller Erinnerungen? Die Erkenntnis, dass ein Einzelner sowieso nichts ändert? Robert Kösch spricht immer noch von “wir”, wenn er über Ärzte ohne Grenzen redet, obwohl er längst zurück in Eimsbüttel, längst zurück an seinem alten Arbeitsplatz bei Airbus ist. Er würde wieder auf Mission gehen. Das nächste Mal vielleicht mit seiner Frau, wenn sie ihr Medizinstudium beendet hat. Denn: „Nur weil etwas komplex ist, heißt das nicht, dass man es nicht angehen sollte.”
Ein Krankenhaus im Kongo
In seinem Buch „Ein Krankenhaus im Kongo“ schreibt der Eimsbütteler Robert Kösch über seine Monate in Baraka. Erschienen ist das Buch im Conbook Verlag.
Eine kürzere Version dieses Artikels erschien am 25.11.2021 in unserem Printmagazin #25.