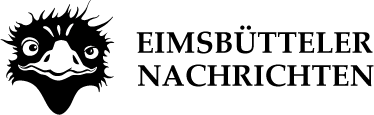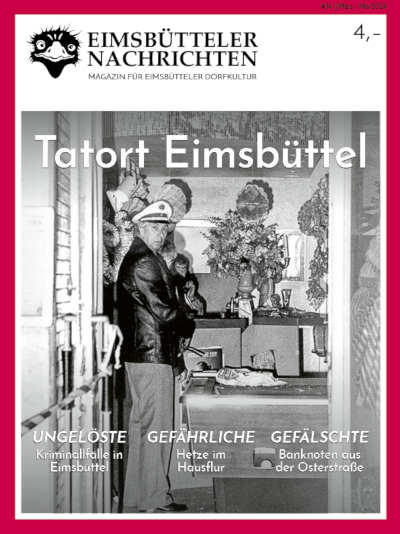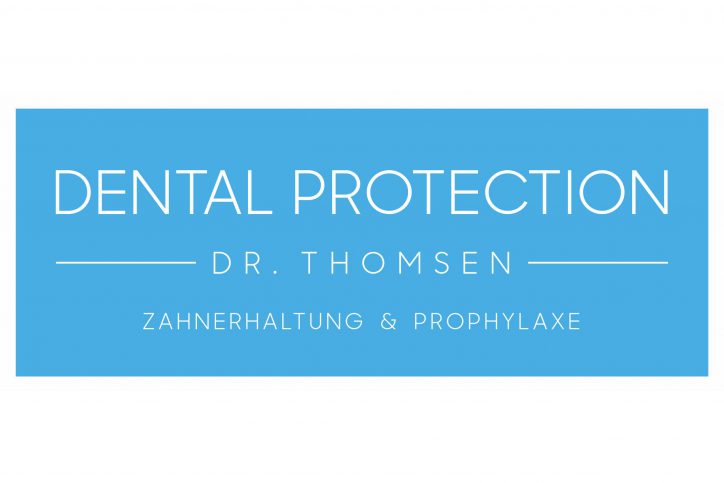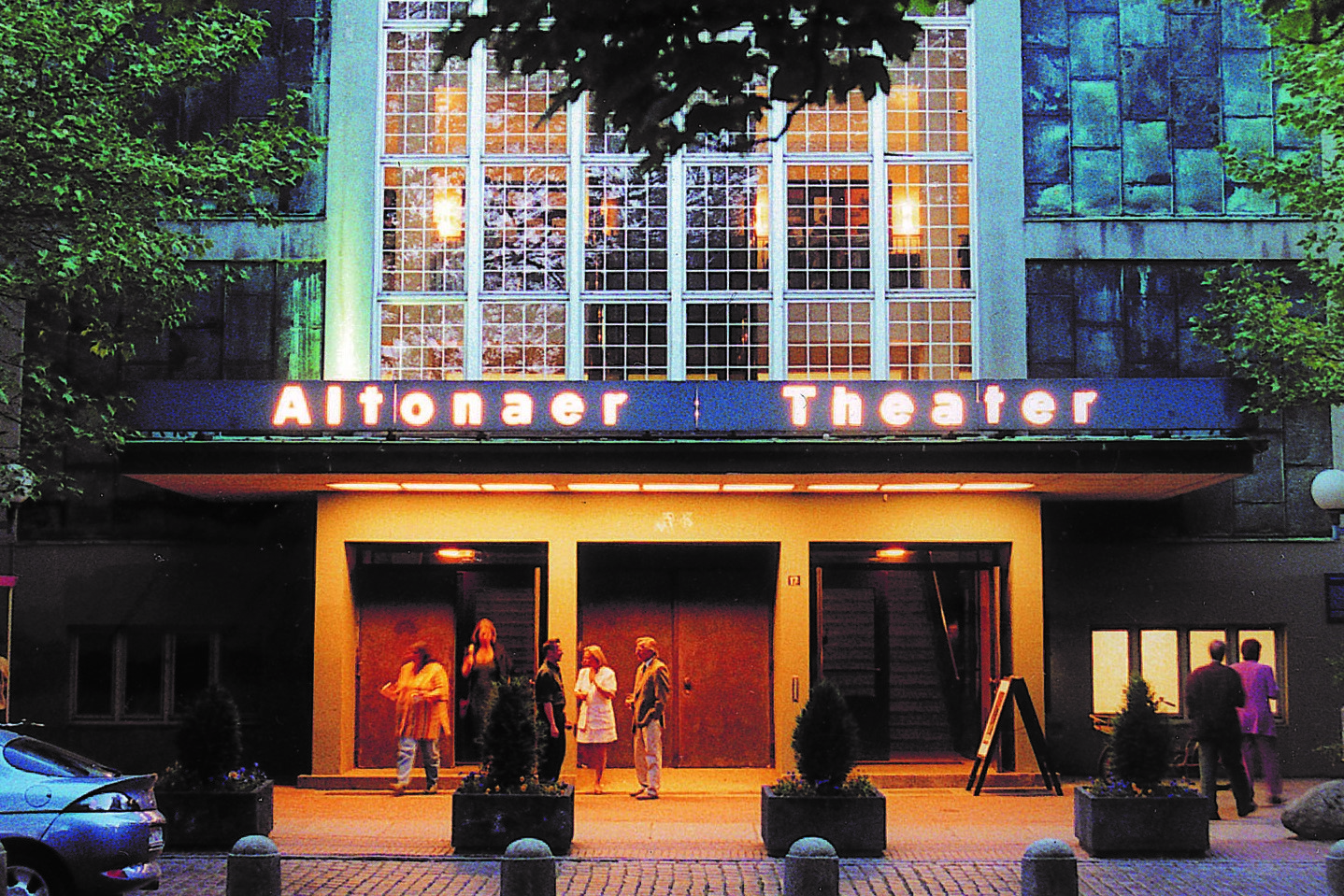Zwangsarbeit und Deportation im Schanzenviertel: Kundgebung erinnert
Hunderte Menschen wurden über die Volksschule Schanzenstraße deportiert, weitere hundert zur Zwangsarbeit genötigt. Mit einer virtuellen Kundgebung will das Schanzenviertel den Opfern gedenken.
Von Julia HaasWo heute die Ganztagsgrundschule Sternschanze bunte Vielfalt leben und lehren möchte, prägten einst die Gräueltaten des NS-Regimes Leben und Lehre. Zwangsarbeit und Deportation ziehen sich wie ein brauner Faden durch die nationalsozialistische Vergangenheit der ehemaligen Volksschule Schanzenstraße/Altonaer Straße.
Mit einer virtuellen Kundgebung am 12. Februar um 18 Uhr wollen Eltern, Lehrer und Menschen aus dem Schanzenviertel an die Opfer erinnern und ein Zeichen gegen das Vergessen setzen.
Schulleiterin lehnte Aufnahme jüdischer Schülerinnen ab
Die traurigen Kapitel der Schulgeschichte beginnen im Jahr 1942. Mit einem Schreiben an die damalige Schulverwaltung der Stadt Hamburg verwehrt die Schulleiterin Emma Lange die Aufnahme jüdischer Schülerinnen aus der geräumten Israelitischen Töchterschule im Karolinenviertel.
Im offiziellen Brief vom 2. April heißt es, der gute Ruf der Volksschule würde durch die Unterbringung der Kindern schwer gefährdet werden. Weiter schreibt sie: „Dieses enge Zusammenkommen arischer Personen mit jüdischen Kindern muss im Dritten Reich als unhaltbar abgelehnt werden.“ Das förmliche Schreiben kann die Brutalität ihrer Worte bis heute nicht verbergen.
Zwangsarbeitslager in der Volksschule Schanzenstraße
Wenige Monate später werden 1.700 jüdische Menschen aus dem Schanzenviertel ins Ghetto Theresienstadt deportiert – darunter die abgewiesenen Schülerinnen. Nur zwei überleben.
Im Herbst 1943 wird aus der Volksschule Schanzenstraße ein bewachtes Zwangsarbeitslager. Kriegsgefangene aus den Niederlanden, Belgien, Dänemark und Italien versuchen dort unter menschenverachtenden Bedingungen zu überleben. Den Großteil der dort untergebrachten Zwangsarbeiter machen 400 italienische Militärinternierte aus.
Italienische Militärinternierte
Nach dem Sturz der faschistischen Mussolini-Regierung im Sommer 1943 und dem Waffenstillstand Italiens mit den Alliierten hatten deutsche Truppen italienische Soldaten festgenommen und entwaffnet. Rund 600.000 der italienischen Militärinternierten wurden nach Deutschland deportiert und zur Zwangsarbeit eingesetzt.
Viele Kriegsgefangene sterben
Sie zählen zu den über 13.500 nach Hamburg deportierten italienischen Kriegsgefangenen. Die Stadt Hamburg und private Unternehmen zwingen sie zur Arbeit in Rüstungsbetrieben und bei der Trümmerräumung.
Etwa 2.000 von ihnen leben im Schanzenviertel und arbeiten bei Unternehmen wie Montblanc in der Schanzenstraße 76/5 (heutige Volkshochschule), dem Rüstungsunternehmen Dennert & Pape im Schulterblatt 58, oder einem Schlachtunternehmen in der Schanzenstraße 62. Bis 1945 sterben hunderte der italienischen Zwangsarbeiter an Mangelernährung, Misshandlungen und wegen fehlender medizinischer Versorgung.
Späte Aufarbeitung
In der Volksschule Schanzenstraße bleibt auch nach Befreiung der Kriegsgefangenen eine Aufarbeitung der NS-Geschichte aus. Bis 1982 leiteten ehemalige NSDAP-Mitglieder die Schule. Noch in den 50er-Jahren bezeichnen sie italienische Militärinternierte als „dreckige Italiener“.
Das Kapitel „Zwangsarbeit“ ist in Politik, Wirtschaft und Öffentlichkeit bis in die 80er-Jahre ein Tabuthema. Erst mit dem Jahrtausendwechsel und der Gründung der Stiftung „Erinnerung, Verantwortung und Zukunft“ erfolgen erste humanitäre Ausgleichszahlungen an zivile Zwangsarbeiter. Italienische Militärinternierte sind bis heute von den Zahlungen ausgeschlossen. Nach Angaben des ehemaligen Stiftungsvorsitzenden Günter Saathoff stufte die Bundesregierung sie trotz schwerer Schicksale nicht als zivile Opfer ein.
Virtuelle Kundgebung
Die von Holger Artus initiierte Kundgebung am 12. Februar will darüber aufklären und an die Opfer in der Volksschule Schanzenstraße erinnern. Mehrere Redner begleiten die Kundgebung – darunter der italienische Generalkonsul für Norddeutschland Giorgio Taborri, der grüne Bürgerschaftsabgeordnete Peter Zamora sowie Orlando Materassi, Präsident der Nationalen Vereinigung der italienischen Militärinternierten.
Die Gedenkveranstaltung beginnt um 18 Uhr auf Zoom. Das Passwort lautet: 202102.
Wann? Freitag, den 12. Februar um 18 Uhr
Wo? Virtuelle Kundgebung auf Zoom, Passwort: 202102