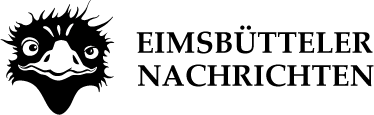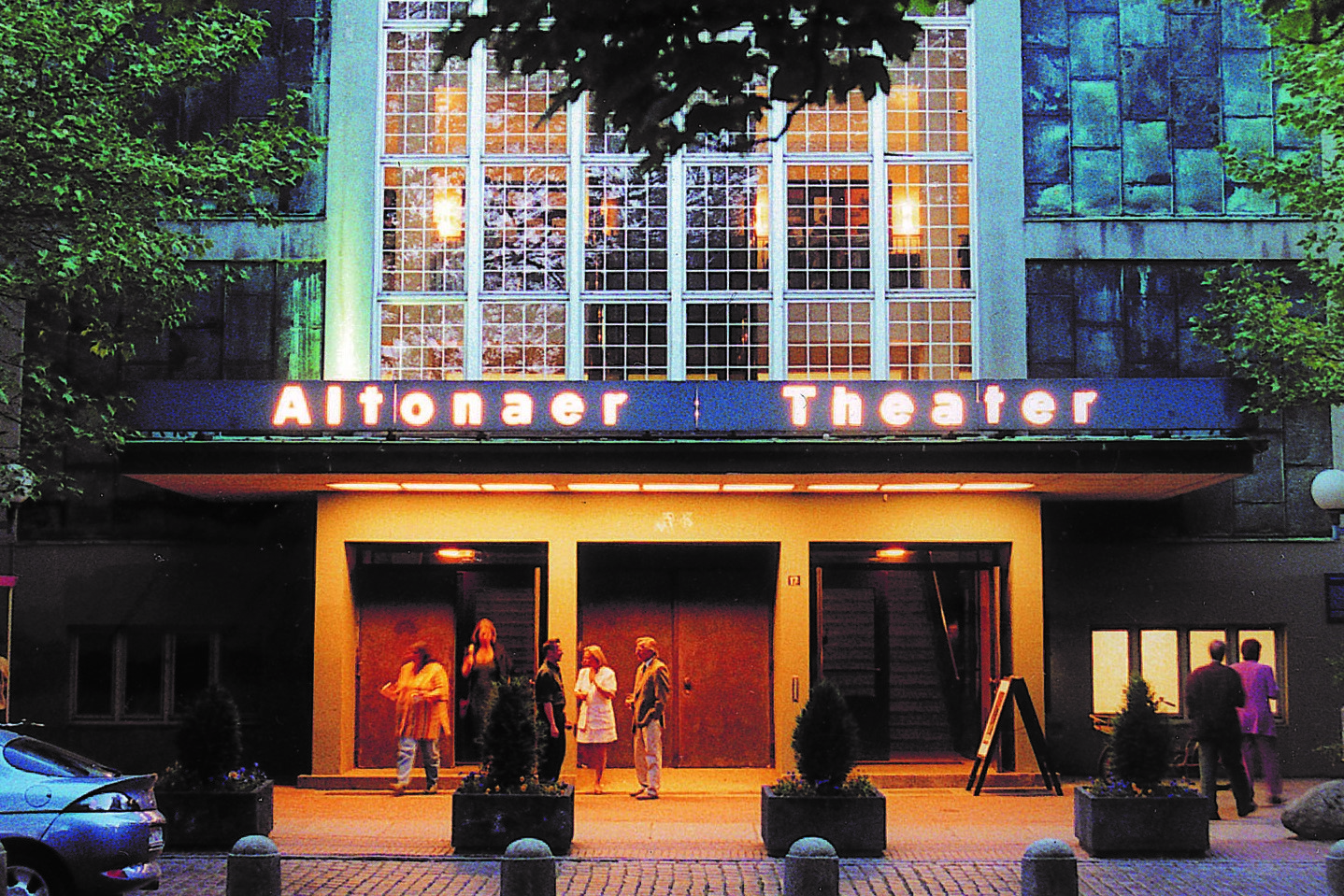„Wo Wohnraum als Betongold gehandelt wird, stirbt das Viertel“
Was Sitzbänke, Fahrradstellplätze und Wohnungsgrößen mit guter Nachbarschaft zu tun haben? Jede Menge. Stadtsoziologin Ingrid Breckner erklärt, was das Miteinander in der Großstadt beeinflusst und wie sich die Identität Eimsbüttels von Altona unterscheidet.
Von Christiane TauerEimsbütteler Nachrichten: Frau Breckner, kennen Sie in Ihrem Haus alle Ihre Nachbarinnen und Nachbarn?
Ingrid Breckner: Ja, tatsächlich kenne ich alle. Ich wohne schon seit 2003 dort. Wir sind neun Parteien in einer Eigentümergemeinschaft und haben dadurch viel miteinander zu tun. Bei uns war es von Anfang an sehr nachbarschaftlich mit gemeinsam im Garten frühstücken und solchen Sachen.
So scheint es nicht in jedem Haus zuzugehen. Eine Forsa-Umfrage von 2019 hat ergeben, dass 12 Prozent der Hamburger keinen oder nur einen ihrer Nachbarn kennen. Bei 18- bis 29-Jährigen waren es 24 Prozent, die niemanden kannten. Bei den Über-60-Jährigen lag dieser Anteil bei nur 1 Prozent. Was sind Gründe für diese unterschiedlichen Zahlen?
Die Unterschiede haben vor allem mit der Struktur der Wohnsituation zu tun. Bei Mietern hängt es häufig von der Wohndauer ab, wie gut sie die Nachbarschaft kennenlernen.
Ein Großteil der jüngeren Menschen kommt zum Studium nach Hamburg. Viele haben im ländlichen Raum gelebt, sind einerseits etwas zurückhaltender und müssen sich eingewöhnen oder bevorzugen andererseits die Anonymität der Großstadt. Die Jüngeren wollen oft Wahlfreiheit bei ihren Kontakten, keine Zwangsgemeinschaft. Dazu kommt: Wer spätabends Mehl oder Eier braucht, ist in Hamburg nicht auf die Nachbarschaft angewiesen, sondern geht zum nächsten Kiosk.
Ältere Menschen hingegen sind eher als jüngere Eigentümer von Immobilien, leben dort länger und beschäftigen sich zwangsläufig mit ihren Nachbarn, zum Beispiel weil sie gemeinsam über Sanierungen entscheiden müssen.
„Kinder sind ein Motor nachbarschaftlicher Beziehungen“
Wer länger in einer Wohnung lebt, kennt mehr Leute im Haus, das ist logisch. Welche Faktoren haben noch Einfluss darauf, wie viele Kontakte ich zu Nachbarn habe?
Kinder gelten als Motor nachbarschaftlicher Beziehungen. Familien kennen sich meist besser untereinander als Singles. Kinder gehen unbefangen auf Leute zu, sie unterscheiden nicht zwischen verschiedenen sozialen oder kulturellen Hintergründen. In der Folge liegt es natürlich an den Beteiligten, was sie daraus machen.
Hat die Pandemie dafür gesorgt, dass Menschen ihre Nachbarn besser kennengelernt haben?
Gerade am Anfang der Pandemie war das durchaus der Fall. Es gab viele Initiativen, um einander zu unterstützen. Mehrere Studien haben aber gezeigt, dass das eher kurzfristige Aktionen waren. Wir hatten studentische Arbeiten, die coronabedingte Nachbarschaftsbeziehungen im Karoviertel mit Buxtehude verglichen haben. Es zeigte sich: Die Beziehungen in Buxtehude waren längerfristig. Im Karoviertel war es eher Aktivismus, der wieder erlahmt ist.
Zur Person
Dr. Ingrid Breckner, Jahrgang 1954, studierte Erziehungswissenschaft und Soziologie an der LMU München. Nach ihrer Promotion in Soziologie an der Universität Bielefeld lehrte sie unter anderem in München, Bochum und Kassel. 1995 wurde sie Professorin für Stadt- und Regionalsoziologie an der TU Hamburg und ab 2006 an der neu gegründeten HafenCity Universität Hamburg. Seit 2021 ist sie im Ruhestand.
Gibt es Viertel in Hamburg, in denen die Kontakte eher hoch sind?
Am Beispiel Altona lässt sich gut zeigen, dass es gewisse Traditionen sind, die den Zusammenhalt fördern. In den 70er-Jahren sind viele Studierende in diesen Stadtteil gezogen und haben gegen die damals geplante, groß angelegte bauliche Umgestaltung protestiert. Sie haben am Ende tatsächlich dafür gesorgt, dass die Stadt dort die erste sanfte Stadterneuerung umgesetzt hat. Aus diesem gemeinsamen Protest sind besondere Beziehungen gewachsen. Viele dieser Leute sind bis heute im Viertel geblieben.
Auch viele Migranten sind mit der dortigen Alternativkultur in Berührung gekommen, woraus sich eine besondere Identität des Stadtteils entwickelt hat, die auch nach außen für ein attraktives Image sorgt. Wenn ich meine Studierenden gefragt habe, was ihr bevorzugter Stadtteil bei der Wohnungssuche war, haben fast alle Altona gesagt.
Eimsbüttel erscheint ihnen nicht so attraktiv?
Eimsbüttel ist für Außenstehende schwieriger zu lesen. Ich glaube, junge Leute würden sich jetzt nicht entscheiden, in die Lenzsiedlung zu ziehen oder noch weiter raus nach Stellingen. Interessant wäre das bürgerliche Eimsbüttel mit seinen Altbauten, aber da sind die Mieten für junge Leute zu hoch. Für sie besteht also eine Barriere, wohingegen Altona zugänglicher erscheint. In Altona gibt es außerdem eine größere Vielfalt. Dort existieren Genossenschaftswohnungen, Mietwohnungen und sozialer Wohnungsbau neben Eigentumswohnungen. Die Bewohner haben durch diese unterschiedliche bauliche Struktur gelernt, mit Diversität in ihrer Nachbarschaft zu leben.
Wie wirken sich steigende Mieten oder Wohnungspreise auf die Struktur der Bevölkerung und nachbarschaftliche Beziehungen aus?
Wo Wohnraum als sogenanntes Betongold gehandelt wird, das dem Investor nur Rendite bringen soll und schlimmstenfalls gar nicht bewohnt, sondern immer weiterverkauft wird, stirbt am Ende das Viertel. Das ist nicht nur in Eimsbüttel oder Altona, sondern hamburgweit ein Problem. Deshalb ist unter anderem die Soziale Erhaltungsverordnung so wichtig. Nur so kann man die Kapitalisierung des Wohnungsmarktes verhindern. Ich kenne ein Haus am Stellinger Weg, wo eine Aufteilung in Eigentumswohnungen auf diese Weise verhindert wurde.
Andere Instrumente sind die Rekommunalisierung von Wohnungen oder der Verkauf von städtischen Grundstücken im Erbbaurecht. Damit die Stadt die Hoheit über den Wohnungsmarkt behält. Wohnraum darf nicht Kapitalverwertungszyklen unterworfen werden, weil damit Mietsteigerungen einhergehen, die besonders Haushalte mit niedrigen Einkommen verdrängen. Dazu gehören viele ältere Menschen, die in ihrem Erwerbsleben keine Anwartschaft für ausreichende Alterssicherung erworben haben.

In der Forschung gibt es den Begriff „Nachbarschaftseffekt”. Gemeint ist die positive oder negative Auswirkung der Nachbarschaft auf Lebensqualität und Zukunftschancen der Bewohner, insbesondere Kinder. Können Sie das näher erklären?
Ich glaube, wenn es um Zukunftschancen der Kinder geht, muss man sich eher Schulen als Nachbarschaften anschauen. Wie sieht dort die soziale Mischung unterschiedlicher Bevölkerungsgruppen aus? Je höher die soziale Ungleichheit in Bildungseinrichtungen ist, destomehr muss es eine engagierte Steuerung der Lernangebote geben.
Viele Baugemeinschaften oder Wohnprojekte, die die Begegnung von Jung und Alt fördern wollen, haben anfangs das Ideal, dass es eine nette Omi gibt, die sich um die Kinder im Haus kümmert und mit ihnen Hausaufgaben macht. Aber diese Omi gibt es in der Realität kaum. Die Gleichung „Die Jüngeren tragen für die Älteren Wasserkisten rauf, im Gegenzug übernehmen sie die Kinderbetreuung” geht nicht auf.
Ähnlich schwierig sind Gemeinschaftsräume, die bei Baugemeinschaften zum Haus gehören. Am Ende steht der Raum oft leer, weil es keine feste Zuständigkeit gibt. Bei Genossenschaftswohnungen ist das anders. Da gibt es professionelle Sozialraummanager oder einen offiziellen Nachbarschaftstreff. Es muss eine Institution geben, die im Quartier für Hilfeleistungen zuständig ist, nur dann kann es funktionieren.
Wenn man eine Ebene höher geht: Wie kann Stadtplanung im Bezirk die Nachbarschaftsentwicklung positiv beeinflussen? Lässt sich das „von oben herab” steuern?
Eigentlich müsste der Bezirk bei jedem Bauantrag genau schauen, was gebaut werden soll. Der Wohnungsschlüssel sollte von vornherein möglichst vielfältig sein und kleine, mittlere und große Wohnungen berücksichtigen. So kommen automatisch unterschiedliche Haushalte und Altersgruppen zusammen.
Hat ein Haus nur Zwei-Zimmer-Wohnungen, ist das für nachbarschaftliche Beziehungen fatal. Denn das zieht zwangsläufig eine höhere Fluktuation nach sich als es größere Wohnungen tun. In Wohnungen mit mehreren Zimmern wohnen vor allem Familien. Die bleiben in der Regel länger. Andererseits finden sie dort aber schwer eine kleinere und günstigere Wohnung, sobald die Kinder aus dem Haus sind.
Außerdem ist Infrastruktur im Erdgeschoss wichtig. Ein Bäcker und ein Mix aus kleineren Läden ist für die Nachbarschaft extrem wichtig. Das sorgt für lebendige Straßen, in denen sich Menschen begegnen, und verhindert, dass Neubauquartiere zu Schlaforten verkümmern.
„Man sollte Nachbarschaft nicht mit Freundschaft verwechseln“
Aber sorgt so ein Mix – darunter fällt ja auch der Drittelmix aus Eigentumswohnungen, frei finanzierten sowie geförderten Mietwohnungen bei Neubauten – nicht für mehr nachbarschaftliche Konflikte?
Das ist zwar möglich, aber die Menschen werden lernen müssen, miteinander klarzukommen. Einfach weil es wichtig ist für die Quartiere. Bei der Planung sollte man nur schauen, wo genau zum Beispiel die Sozialwohnungen entstehen. Hier hat sich gezeigt, dass ein Mix auf Ebene eines Hauses tatsächlich konfliktträchtiger ist als wenn der Mix Haus für Haus erfolgt. Grundsätzlich lassen sich durch gute Planung viele Konflikte vermeiden. Das betrifft vor allem die Gemeinschaftsfläche. Wo können Fahrräder stehen? Welchen festen Ort bekommen Kinderwagen? Wo wird der Spielplatz gebaut, damit sich möglichst wenige Nachbarn gestört fühlen? Das alles sind kleine Stellschrauben, die große Wirkung haben.
Ich bin überzeugt, dass man den öffentlichen Raum viel stärker als Gemeinschaftsfläche nutzen sollte. Die Autorin Jane Jacobs hat in ihrem Buch „Tod und Leben großer amerikanischer Städte” geschrieben, dass der Ort der nachbarschaftlichen Begegnung der Gehsteig ist. Oder der Park, oder eine Bank vor dem Haus. Diese Potenziale sollte man viel mehr nutzen.
Das heißt, mit einer Sitzbank kann jeder Einzelne zu guten nachbarschaftlichen Beziehungen beitragen?
Ja, das ist in der Tat so. Ein Straßenfest kann es natürlich auch sein. Man sollte Nachbarschaft aber nicht mit Freundschaft verwechseln. Die Nähe-Distanz-Beziehung muss jedem klar sein, auch wenn der eine vielleicht öfter zusammen was trinken gehen würde, dem anderen aber ein kurzer Schnack vor dem Haus reicht.
Das Allerwichtigste aber ist, dass man beim Nachbarn klingelt und mit ihm spricht, wenn einem etwas nicht passt. Den Ärger sollte man keinesfalls runterschlucken, bis der Frust zu groß wird.