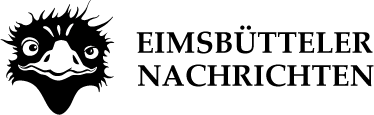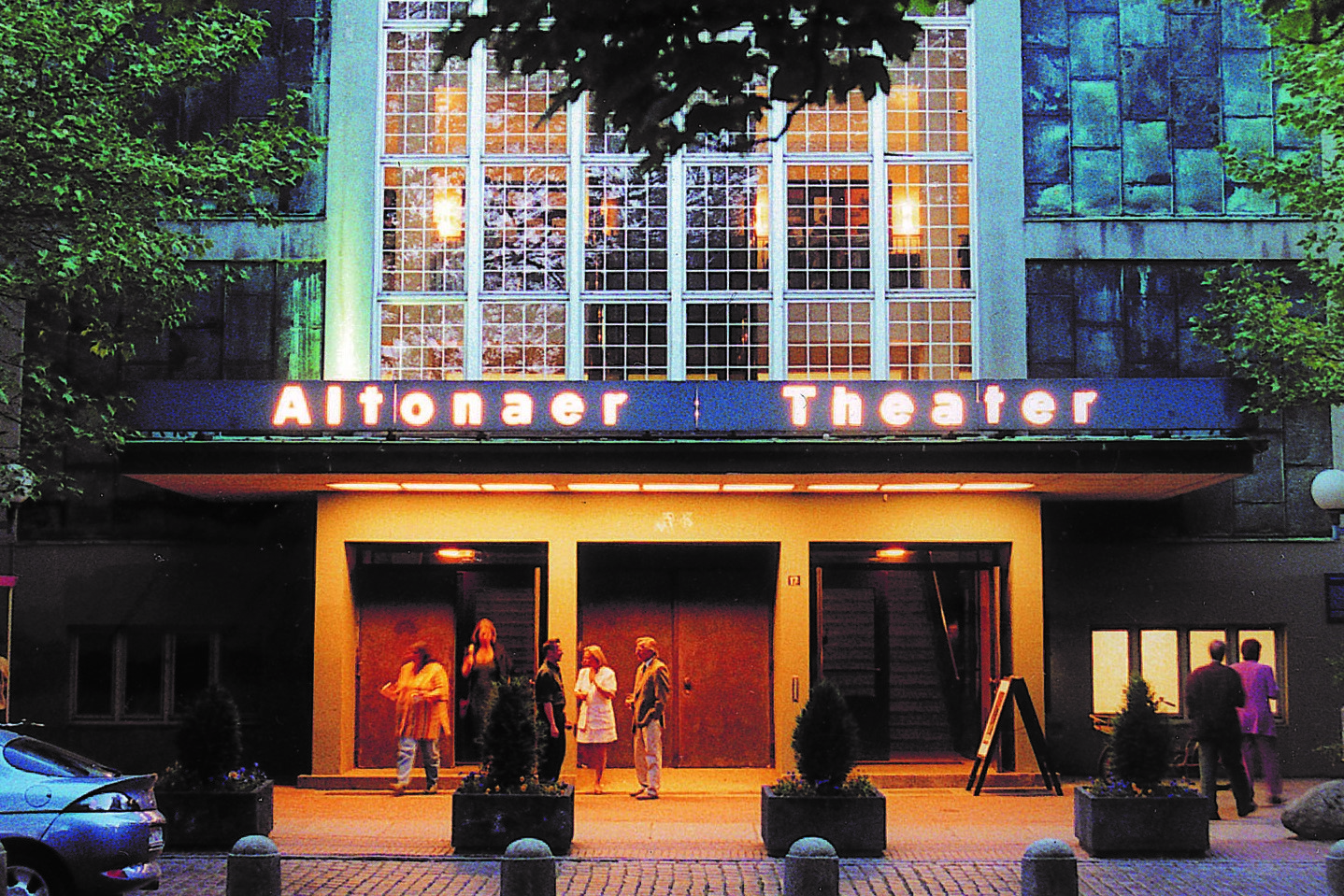Eimsbüttels Wellenbrecher
Wir sehen das Auf und Ab der Zahlen und manövrieren uns von einer Welle zur nächsten. Währenddessen wütet das Virus weiter in Körpern und Gesellschaften und zwingt Milliarden Menschen, anders zu leben, zu arbeiten, zu sterben.
Von Eimsbütteler NachrichtenWie Corona die Arbeit einer Ärztin, einer Pflegerin, eines Bestatters und eines Einzelhändlers in Eimsbüttel verändert hat. Und was passiert, wenn es in die Familie eindringt.
Text: Alana Tongers und Vanessa Leitschuh
Gerät ein Schiff in einen Sturm, müssen schnelle Entscheidungen getroffen werden. Das Richtige tun, um die Menschen an Bord zu schützen. Kurs und Geschwindigkeit anpassen und abwarten, bis der Sturm über das Schiff hinweggefegt ist. Beim Segeln nennt man das abwettern.
Auch in der Notaufnahme des Agaplesion Diakonieklinikum Hamburg werden Entscheidungen getroffen, wenn sich die Schiebetür leise surrend öffnet. Links oder rechts? Symptome oder symptomlos? Eine rote Wand trennt seit Monaten den Eingangsbereich der Ambulanz. Infektiös steht in großen Buchstaben auf der einen Seite. Nicht-infektiös auf der anderen.
Judith Röder steht zwischen den Welten, die sich anhand zweier Flure teilen. Die 45-jährige Internistin leitet die Notaufnahme der Klinik in der Hohe Weide. Die langen blonden Haare hat sie hochgesteckt, keine herabfallende Strähne soll ablenken. Wenn sie arbeitet, dann muss sie bereit sein – das Unerwartbare gehört zu ihrem Beruf. „Die Notaufnahme ist ein Stoßgeschäft”, sagt Röder.

Sie müssen schnell reagieren auf das, was durch die Tür kommt. Es sind die täglich neuen Herausforderungen, die sie an ihrem Beruf liebt. Mal bricht jemand noch vor der Ambulanz zusammen. Mal kommt ein Kind im Auto auf dem Parkplatz zur Welt. Doch mit Corona wurde das Unerwartbare zum Unvorhersehbaren.
Wie die Notaufnahme des Agaplesion teilt sich auch der Rest des Landes in zwei Welten. Die Corona-Welt, in der Menschen mit dem Virus ringen und Ärzte versuchen, die neue Krankheit zu verstehen. Und eine andere Welt, in der das Virus weit weg ist und trotzdem bestimmt, wie Menschen leben, arbeiten, lieben.
Von den wirtschaftliche Folgen
Karsten-Wolfgang Kurth war lange Teil der letzteren. Für ihn hatte das Virus vor allem wirtschaftliche Folgen, bedrohte die Existenz seines Ladens. Die Eimsbütteler kennen Kurth als den Seifenmann. Seit über zehn Jahren betreiben er und seine Frau das Hamburger Seifenkontor. Das kleine Ladengeschäft liegt im Souterrain des „Katzenhauses” nahe der Hoheluftbrücke. Im Fenster steht ein alter Krämerladen mit Miniaturseifen, daneben stapeln sich Seifenklötze aus dem Zweiten Weltkrieg. Funde von Antikmärkten. Für Kurth ist Seife längst zur Passion geworden.
Vor zehn Jahren, als er und seine Frau das Seifenkontor eröffneten, waren die beiden für viele die „Spinner mit der festen Seife”. Heute ist das anders. Das Bewusstsein hat sich gewandelt, hin zu einem nachhaltigeren Konsum. Und trotzdem: In keinem Jahr zuvor war Seife so essentiell wie jetzt. Im Katastrophenfilm Armageddon 2020 wäre Seife vielleicht nicht Bruce Willis gewesen, aber sie hätte zumindest in seinem Team gespielt.
Denn der Erreger mit dem sperrigen Namen SARS-CoV-2 besteht wie alle Coronaviren aus einer Fetthülle, welche die Erbinformation RNA umschließt. Seife löst diese Hülle. Die RNA kann sich nicht mehr vermehren, das Virus wird unschädlich. Wenn Seife zum Krisenheld wird, sind Seifenläden dann Krisenprofiteure? Nicht das Seifenkontor. Das Herunterfahren der Wirtschaft machte dem Laden zu schaffen. Im ersten wie im zweiten Lockdown: Leere im Laden. Obwohl er als Drogerie öffnen darf. „Und täglich grüßt das Murmeltier”, resümiert der 55-Jährige Ladeninhaber Ende Januar.
Richtig gut lief es Ende November: In diesem Jahr sollte sich Pflanzenseife unter den Weihnachtsbäumen türmen. Es ist die beste Verkaufszeit des Jahres. Bis sich das Virus Anfang Dezember in Kurths Familie einnistet.
Zwischen Infektion und Isolation
Der mittlere von drei Söhnen steckte sich in der Schule an. Als er erste Symptome zeigt, hat er das Virus bereits an den Rest der Familie weitergegeben. Arztruf 116 117. Am Abend fährt das Auto vor, Menschen in Schutzanzügen testen die Familie im Hauseingang. Am nächsten Tag der Anruf aus dem Labor: Positiv. Alle fünf. Das ist ein Schock. Aber da ist auch Erleichterung: Sie werden es zusammen durchstehen. Keiner muss aus dem engsten Kreis ausgeschlossen, von der eigenen Familie isoliert werden. Am Tag darauf meldet sich das Gesundheitsamt: Keiner darf die Wohnung verlassen, auch nicht die Hündin. Fünf Menschen, ein Hund, eine Wohnung – für zwei Wochen. Und die Frage: Was wird in den nächsten Wochen auf die Familie zukommen?
Internistin Judith Röder erinnert sich noch gut an den ersten Covid-Patienten, den sie letztes Jahr in die Notaufnahme schoben. Er hatte sich im Urlaub in einem Skigebiet infiziert. Damals herrschte Aufregung auf den Fluren. Pflegerinnen und Pfleger huschten umher, die Neuigkeiten vom ersten Corona-Patienten verbreiteten sich mit angespanntem Flüstern. Das Virus bekommt in der Notaufnahme des Agaplesion sein erstes Gesicht. Mittlerweile hat es viele: Reiserückkehrer, junge Menschen, betagte Ehepaare. Und mit der Menge an Patienten ist das Virus auch für die Mitarbeitenden der Klinik zur Routine geworden.

Dass sich das schnell ändern kann, wissen sie aus dem letzten Jahr. Über Wochen hinweg überschlagen sich die Ereignisse. Täglich müssen sie den Kurs neu bestimmen, sich dem Seegang anpassen. Neue Erkenntnisse werden in Regeln und Verordnungen übersetzt und sammeln sich auf Papieren an Infotafeln. Nichts hat lange Bestand. „Es war verrückt, jeden Morgen in die Klinik zu kommen und sich erstmal auf den neuesten Stand bringen zu müssen”, erinnert sich Birgit Farnbacher. Wenn sie unter der Maske lacht, beschlägt ihre Brille leicht. Und sie lacht oft, wenn sie von der Arbeit erzählt. Farnbacher liebt ihren Beruf. Die 60-Jährige ist im pflegerischen Bereich tätig und bildet gemeinsam mit Röder die Leitung der Notaufnahme.
Mit stoischer Ruhe haben sie die Ambulanz gemeinsam durch die Tage der Unsicherheit manövriert: Als sie Masken zählen mussten, weil die Vorräte mit jedem Tag knapper wurden. Oder als sie die Nachrichten aus dem italienischen Bergamo erreichten. Bilder von gestapelten Särgen und überfüllten Krankenhäusern. „Da haben wir gemerkt: Es kommt”, sagt Judith Röder. Die Zahlen von 300, 500, 800 Toten täglich aus der Lombardei sorgten für Unruhe. Ende des Jahres sterben in Deutschland rund 1.000 Menschen am Tag an den Folgen einer Infektion. Die hohen Zahlen, die so lange ein Problem der Anderen waren, sind nun hier. „Das konnte man sich hier lange nicht vorstellen”, sagt Röder nachdenklich.
Am Ende
Der Tod ist eine Zahl geworden. Er dröhnt aus Radios, prangt in großen Lettern auf Titelseiten, bahnt sich in Diagrammen seinen steilen Weg nach oben. Jeden Tag aufs Neue.
Die Konfrontation mit dem Tod, die Corona so alltäglich gemacht hat, kennt Christian Hillermann bereits seit 18 Jahren. Denn er arbeitet dort, wo sich Tod und Leben begegnen. Hillermann ist Inhaber des Bestattungsinstituts trostwerk in der Osterstraße. Sein Beruf hat ihn mit dem Tod vertraut gemacht. Er kennt ihn in all seinen Facetten. Manche Leben enden plötzlich und unerwartet, andere ruhig und erfüllt. Der Tod findet in Form von Autounfällen, Herzstillständen und Schlaganfällen zum Bestatter.
Seit letztem Jahr hat sich unter vielen möglichen Todesursachen eine weitere eingeschlichen. Zunächst nur als kleiner Prozentsatz. Doch zuletzt stieg die Zahl der Covid-19-Toten in Deutschland und Hamburg erheblich. So dass es sich auch in Hillermanns Arbeit bemerkbar macht. „Seit Anfang des Jahres haben wir deutlich mehr Verstorbene, die an einer Covid-19-Erkrankung gestorben sind, als vorher”, sagt er.

Die täglichen Zahlen aus den Nachrichten, sie bekommen im trostwerk für Hillermann und seine Mitarbeitenden ein Gesicht und eine Geschichte. Erzählt werden ihre letzten Kapitel von den Angehörigen, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen umgehen müssen. Die Bestatter auf der anderen Seite des Tisches werden dann selbst Teil dieses allerletzten Abschnitts – sie wirken am Schlusswort der Lebensgeschichten mit. Für Hillermann ist das ein Traumberuf. Er redet gerne über den Tod und will, dass das normaler wird.
Bestatter ist er unter anderem geworden, um das Thema zu enttabuisieren. Vor allem aber will er diejenigen stärken, die mit dem Verlust eines geliebten Menschen leben müssen. Manchmal sei das leichter, manchmal schwerer. Es sitzen Menschen vor ihm, die jemanden in hohem Alter und mit erfülltem Leben verabschieden müssen. Und dann kommen Familien, die eine geliebte Person plötzlich und auf traumatische Art und Weise verloren haben.
Hinter verschlossenen Türen
Auch bei Covid-Toten komme das Ende häufig verstörend. „Von der Diagnose bis zum Versterben vergehen gerade bei älteren Menschen oft nur drei bis vier Wochen”, so der Bestatter. Das Virus erschwert den Abschied. Jeder, erzählt Hillermann, träumt vom Tod im eigenen Zuhause. Vom Zusammenkommen mit den Liebsten, dem letzten Händedruck und einem langsamen, friedlichen Einschlafen. Wer an den Folgen des Virus stirbt, ist meist alleine. Verbringt die letzten Wochen, Tage und Stunden isoliert hinter Schichten aus Plastik und geschlossenen Türen. Den Hinterbliebenen bleibt wenig Zeit und Raum zum Abschied.
11% mehr Sterbefälle
als im Durchschnitt der Vorjahre wurden im November 2020 registriert. In Sachsen waren es sogar 39% mehr Sterbefälle. Das ergab eine Sonderauswertung der vorläufigen Sterbezahlen in Deutschland des Statistischen Bundesamts.
Christian Hillermann und sein Team versuchen, den Trauernden diese Möglichkeit zurückzugeben. Ihnen ist es wichtig, dass sich Familie und Freunde nicht nur zeremoniell, sondern auch ganz direkt, mit physischem Kontakt verabschieden können. Damit sie sehen, riechen und begreifen können, dass in dem ihnen vertrauten Körper kein Leben mehr steckt. Hillermann weiß, dass der nahe Kontakt zu den Toten vielen Angst macht. Doch er hält ihn für wichtig – um den Tod zu akzeptieren.
Denn der Mensch ist tot – das Virus aber lebt weiter
Das trostwerk soll ein Ort der Begegnung zwischen Lebenden und Toten sein. Damit das auch in den Tagen der Pandemie funktioniert, müssen die Bestatterinnen und Bestatter präziser arbeiten als sonst. Denn der Mensch ist tot – das Virus aber lebt weiter. Jede Verstorbene und jeder Verstorbene ist potenziell infektiös. Zwar stecken die Toten niemanden mehr über ihren Atem an. Doch wenn die Bestatter sie bewegen, können Aerosole freigesetzt werden. Sie müssen vorsichtig sein, wenn sie die Körper heben und drehen. Ihnen das letzte Mal den Lieblingspullover über die Nase streifen oder die Haare bürsten. „Wenn die Toten erstmal von uns gepflegt und angezogen sind und auf dem Rücken gemütlich im Sarg liegen, geht keine Gefahr mehr von ihnen aus.” Dann gilt es, den Angehörigen die Angst zu nehmen und sie zu ermutigen, sich dem Abschied zu stellen.

Die Infektionen steigen, die Krankenhäuser füllen sich, die Intensivbetten und schließlich die Särge. Wie Wasserterrassen nach und nach überlaufen, so schwappt die Welle auch in das Bestattungswesen. Auch im trostwerk merken sie: Die zweite Welle ist tödlicher als die erste.
Spuren des Schutzes
Doch zuvor wird die Notaufnahme zum Spiegelbild des Eimsbütteler Infektionsgeschehens. Sinken die Zahlen, kommen weniger Erkrankte in die Notaufnahme.Steigt die Kurve, öffnen sich die Schiebetüren der Ambulanz in kürzeren Abständen. „Gibt es einen Ausbruch in einem Pflegeheim in der Nachbarschaft, sehen wir die Patienten wenig später hier”, erzählt Pflegerin Farnbacher. So kritisch wie in Sachsen sei die Situation hier zwar nie geworden, aber kritisch genug: Es gab Tage, an denen sich das Agaplesion „auf rot melden musste”, an denen rund 30 infizierte Patienten auf den Isolierstationen lagen.
Die ständige Anspannung, das Warten auf das Unerwartbare – das alles gehört zum Alltag in der Notaufnahme. Doch Corona verstärkt, was ihre Berufe ohnehin schon anspruchsvoll macht. „Wir können uns keine Angst erlauben”, sagt Birgit Farnbacher. Und doch hat sie Respekt, kann den Gedanken an eine mögliche Ansteckung nicht ganz verdrängen. Sie erzählt vom Kontakt zu älteren Patienten, die husten und spucken. Von Momenten, in denen das Virus ganz nah ist. Und von der eigenen Panik, die zwischendurch die Oberhand gewinnt. Dann heißt es kurz sammeln, Luft holen – und weitermachen. Zur psychischen Belastung kommen die körperlichen Anstrengungen.

Wenn sie infizierte Patienten behandeln, müssen die Mitarbeitenden der Notaufnahme spezielle Schutzkleidung tragen. Sich immer wieder aus- und anziehen. Fünf bis zehn Minuten dauert das jedes Mal, erzählt Röder. „Und es wird anstrengend.” Alles muss sitzen, dem Virus darf keine Fläche zum Angriff bleiben. Schicht um Schicht, bis die Person hinter der Kleidung kaum mehr zu erkennen ist. Die Schutzbrillen und Masken saugen sich an der Haut fest, fangen an, Spuren zu hinterlassen. Da komme es schon mal zu Schnappatmung und Schweißausbrüchen, sagt Farnbacher.
„Es ist erschreckend, in welchem Zustand die Menschen zum Teil sind”
Doch obwohl die Schutzkleidung wie eine Rüstung sitzt, kann sie nicht zu hundert Prozent schützen. Ein Restrisiko bleibt, wenn Farnbacher und ihre Kolleginnen und Kollegen im Infektionsbereich Erkrankte versorgen. „Manchmal werde ich ganz schön sauer, wenn du da reingehst”, rügt Röder die Pflegerin liebevoll. Denn Birgit Farnbacher gehört selbst zur Risikogruppe. „Das kann doch jemand von den jüngeren Kollegen machen.” Farnbacher lacht.
Sie müssen aufeinander aufpassen. Und das tun sie auch. Nur als Team kämen sie durch die Krise, sagt die 60-Jährige. Über Monate haben sie die neuen Vorschriften verinnerlicht, arbeiten eingespielt zusammen, ergänzen sich in Bewegungsabläufen. Aus Unsicherheit und Chaos haben sie ein Konzept gebaut, das dem Virus wehrhaft entgegensteht. Das Virus ist in ihrem Alltag angekommen, und sie können damit umgehen.

Dafür wird die Pandemie jetzt auch in anderen Bereichen sichtbar: Rund 20.000 Patientenkontakte hätten sie in der Notaufnahme des Agaplesion normalerweise jedes Jahr. Seit Beginn der Pandemie kämen weniger Menschen, sagt Röder. Einschätzungen der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) bestätigen: Die Patientenzahlen in Notaufnahmen gingen im Vergleich zu Vorjahren im zweiten Shutdown um 30 bis 40 Prozent zurück.
Viele hätten Angst vor einer Ansteckung im Krankenhaus, vermutet Judith Röder. Oft sei diese Sorge größer als die Schmerzen. Wenn Patienten dann endlich die Notaufnahme aufsuchen, ist es oft zu spät. „Es ist erschreckend, in welchem Zustand die Menschen zum Teil sind”, berichtet Röder. Und fügt hinzu: „Oft wünschte ich, sie wären früher gekommen – dann hätte man mehr tun können.”
Erkrankung mit vielen Gesichtern
Wie sich Corona in allen Teilen der Gesellschaft ausbreitet, so nistet es sich auch im Körper der Infizierten an vielen Stellen ein. In der Lunge. Im Herzen. Den Nieren, der Leber. Im Darm. Über die Blutbahnen gelangt das Virus in die Organe, selbst ins Hirn. Auch das Blut kann zum Problem werden, kann gerinnen.
Dass Covid-19 eine Erkrankung mit vielen Gesichtern ist, zeigte sich auch bei der Familie Kurth. Fünf Infizierte, fünf unterschiedliche Krankheitsverläufe. Den „normalen Verlauf” gibt es nicht. Während der jüngste Sohn, 13 Jahre alt, keine Symptome zeigt, reichen sie beim Rest von Kopf bis Fuß. Grippesymptome zunächst: Der Kopf schmerzt, die Glieder auch. Reizhusten, Fieber. Bis zwei Familienmitglieder Geruchs- und Geschmackssinn verlieren.
Der Familienvater hat zwei Tage lang Kopfschmerzen, leichtes Fieber. Dann verschwinden die Symptome wieder. Er fühlt sich besser. Doch die zweite Welle kommt – an Tag Fünf. Und sie wird heftiger als die erste. Das Virus überrollt ihn. Das Fieber schnellt in die Höhe. Über 40 Grad, sieben Tage lang.
Schlimme Hustenanfälle plagen ihn. Das Virus zersetzt die menschlichen Zellen. Der Körper wehrt sich mit Husten, will zerstörtes Zellmaterial loswerden. Das Immunsystem fährt die Temperatur hoch. Mediziner des Agaplesion wissen, dass sich bei Covid-Patienten im Krankenhaus die Symptome nach sieben bis zehn Tagen verschlechtern können. Im schlimmsten Fall müssen sie dann auf die Intensivstation. Denn wütet das Virus an zu vielen Stellen im Körper gleichzeitig, kann es passieren, dass das Immunsystem überreagiert. Das wäre, als setzte der Kapitän bei tobender See mehr Segel, statt abzuwettern. Mediziner nennen das einen Zytokin-Sturm: Der Körper richtet sich in seiner Verzweiflung gegen sich selbst. Doch ob diese Reaktion bei Karsten-Wolfgang Kurth eingetreten ist, lässt sich nicht einschätzen.
»Ich stelle mir das Schlimmste vor und tue alles, damit es nicht eintrifft«
Tagsüber dieser Hunger nach Luft. Nachts die Schlaflosigkeit. Am frühen Morgen endlich der erlösende Schlaf. Um halb 8 klingelt das Telefon: Der tägliche Kontrollanruf aus dem Gesundheitsamt. „Wie geht es Ihnen heute? Welche Symptome haben Sie?” Neben den Anrufen dokumentiert jeder Erkrankte seinen Verlauf über ein Online-Tagebuch. Mit hohem Fieber ist das nur schwer zu meistern. An einigen Tagen füllt der jüngste Sohn neben Homeschooling-Aufgaben die Corona-Tagebücher der Familie aus.
Es ist keine Panik, die in Kurth aufkommt. Es ist der Instinkt, seine Familie zu schützen. Also trifft er Vorkehrungen. Bereitet seine Familie darauf vor, was zu tun ist, wenn seine Lunge nicht mehr kann, ihm die Luft wegbleibt. „Ich stelle mir das Schlimmstmögliche vor und tue alles, damit es nicht eintrifft”, sagt er. Dann zitiert er frei Woody Allen: „Ich glaube zwar nicht an ein Leben nach dem Tod, packe aber vorsichtshalber einen Pyjama ein.”
Aber es geht alles gut. Einem Familienmitglied nach dem anderen geht es besser. Die Quarantäne ist vorbei, die Entlassungsschreiben vom Gesundheitsamt sind gekommen.

An diesem Weihnachtsfest liegen bei der Familie Kurth keine Geschenke unterm Baum. Auf Wunsch der Kinder. In der deutsch-französischen Familie hat das Essen sowieso einen höheren Stellenwert – und das Beisammensein. Sie beschenken sich mit etwas Normalität, feiern das Fest wie sonst auch. Außer, dass Zweien noch immer Geschmacks- und Geruchssinn fehlen.
Überstanden – oder nicht?
Der gelernte Volkswirt arbeitete früher als Berater in einem Krankenhaus. Nüchtern referiert er über die Erkrankung, nennt Fakten und Fachbegriffe. Aber er sagt auch: „Wenn sich niemand um mich gekümmert hätte, hätte ich ins Krankenhaus gemusst.”
Weder er noch sein Laden haben den Rückschlag ganz überstanden. Er kämpft noch immer an zwei Fronten. Das Seifenkontor musste in der besten Zeit des Jahres schließen. Hilfsangebote, wie das einer befreundeten Gastronomin, sich im Laden hinter den Tresen zu stellen, musste Kurth ablehnen. Ohne Einweisung wäre das unmöglich gewesen. Im nächsten Notfall wird er einen Plan B haben. Auch anderen rät er, frühzeitig Netzwerke zu knüpfen, um vorbereitet zu sein.
Immer wieder macht er Pausen beim Sprechen. Auch sein Körper hat die Erkrankung noch nicht ganz überwunden. In den ersten Wochen schafft er es nur schwer zu seiner Wohnung im vierten Stock. Für den Gang zur Hausärztin braucht er statt 15 Minuten 30. Über Wochen liegt eine bleierne Müdigkeit über allem. Die Beine krampfen, ständig dieses Herzrasen.
Aber schlimmer als Erschöpfung oder Kurzatmigkeit ist für Kurth die mangelnde Konzentration. Phasen der Aufmerksamkeit sind kürzer, Fäden gehen schneller verloren. Viele Dinge dauern das Fünfzehnfache der Zeit. „Das baut innerlich Stress auf. Auch die Frage: Was ist da passiert?” Und gerade Stress ist es, was Frischgenesene wegen der erhöhten Herzaktivität vermeiden sollten.
Wieder und wieder betont der Eimsbütteler, wie dringlich es sei, nach einer Covid-Infektion in Behandlung zu gehen. Ihm habe dieser wichtige Hinweis vom Gesundheitsamt gefehlt. Denn immer mehr Studien zeigen: Langzeitschäden betreffen nicht unbedingt nur Erkrankte mit einem schweren Verlauf. Auch die Mediziner des Agaplesion raten, die Krankheit mit einem Hausarzt zu besprechen. In einem von zehn Fällen habe die Erkrankung einen längeren Verlauf. Noch gibt das Phänomen „Long Covid” viele Rätsel auf. Kurth lässt sich regelmäßig von seiner Ärztin durchchecken.
Die Scham der Infizierten
In seinem Seifenladen geht Kurth offen mit der Erkrankung um. Sie sollte greifbarer werden, findet er. Aber als die Familie von der Infektion erfährt, wird ihnen von Freunden und Bekannten geraten, es nicht öffentlich zu machen.
„Ich bin erstaunt, wie sich die Leute schämen”, sagt Kurth. Das mache die Krankheit abstrakt, so fangen Menschen an, sie zu leugnen. Stigmatisierung bei unbekannten Infektionskrankheiten ist nicht neu, aber ein Problem. Aus Studien zu HIV oder SARS weiß man, dass Erkrankte aus Scham teilweise erst spät Hilfe suchen. In der Zwischenzeit verbreiten sie das Virus weiter. Auch die Ausgrenzung kann sich psychisch und körperlich auf Betroffene auswirken.

Kurth spricht offen darüber. Viele Kunden trauen sich dann von ihrer eigenen Infektion zu berichten. „Ich hatte es schon im März. Wie war es denn bei dir?”, bekommt er oft zur Antwort. Er findet, jeder sollte seine Erfahrungen teilen, ohne Scham über alle Symptome sprechen – besonders mit Fachärzten. „Denn die Medizin lernt durch Post-Covid-Menschen täglich dazu. Trotz der Nachwirkungen hält er am Motto seines Ladens fest: „In unserer Zukunft scheint die Sonne.” Er will sich gerade in dieser Zeit die gute Laune bewahren.
In seelische Unwetter eintauchen
In Christian Hillermanns Beruf ist das nicht immer leicht. Das stetige Überwinden gehört für ihn zur beruflichen Routine. Immer wieder gibt es Momente, in denen ihm die Worte fehlen. In denen die Trauer der anderen kaum auszuhalten ist. In diesen Momenten würde er sich der Konfrontation am liebsten entziehen. „Wir tauchen in das seelische Unwetter anderer Menschen ein”, sagt er. Die Bestatter müssen die Trauer mit ausbaden. Oft brauche es Mut, sich so tief ins Ungemach Fremder zu begeben. Und an manchen Tagen ist er mutiger als an anderen.
Doch Hillermann weiß, wie wichtig Bestatter sind, die ihre Arbeit empathisch und ehrlich ausführen, für die eine Beerdigung mehr ist, als bloß eine Dienstleistung. Diese Bestatter geben den Hinterbliebenen das Gefühl: „Ich stehe neben dir, ich stehe hinter dir, du hältst das aus.” Sie bringen die Toten und die Lebenden so nah wie möglich zueinander. Gerade jetzt, wo das Sterben so ungreifbar weit weg auf Isolierstationen passiert und gleichzeitig so präsent im täglichen Bewusstsein ist.
Christian Hillermann ist froh, dass die Todeszahlen in Hamburg bislang auf vergleichsweise niedrigem Niveau geblieben sind. Nicht so wie dort, wo Intensivstationen und Krematorien zwischenzeitlich ausgelastet waren, und niemand wusste, wohin mit Kranken und Toten. Und trotzdem beunruhigen ihn die Entwicklungen der letzten Wochen, die sich durch die Corona-Toten in den Räumen seines Unternehmens widerspiegeln. Das Ende, es könnte in seinem Beruf nicht präsenter sein. Das Ende der Pandemie hingegen, meint Hillermann, ist für sie noch nicht in Sicht.
Wann es besser wird, will auch Judith Röder nicht vermuten. Über Wochen haben sie ihr Schiff in Schräglage gehalten, Winddruck ausgeglichen, für Stabilität gesorgt. Doch je höher die Wellen schlagen, desto weniger Sichtweite hat man. Und wie beim Wetter, lassen sich auch für das Virus keine exakten Voraussagen treffen. Hinzu kommt die Unsicherheit, die in Form von Mutationen näher rückt. Röder hat Respekt davor. Was, wenn die Zahlen wieder steigen? Die bisherigen Schutzkonzepte nicht mehr ausreichen? In den letzten Tagen sei es in der Ambulanz ruhig gewesen. Judith Röder und Birgit Farnbacher hoffen, es ist nicht die Ruhe vor dem nächsten Sturm.