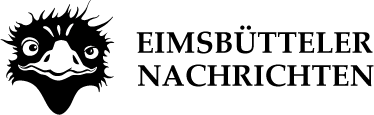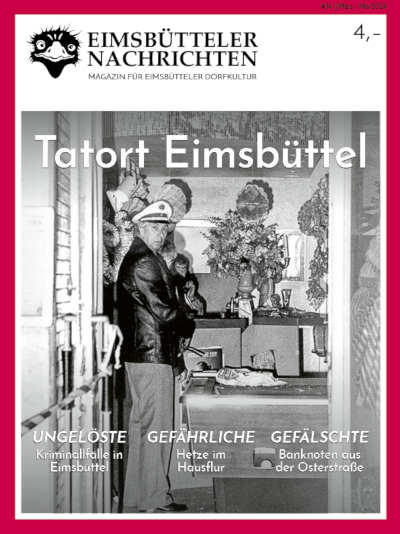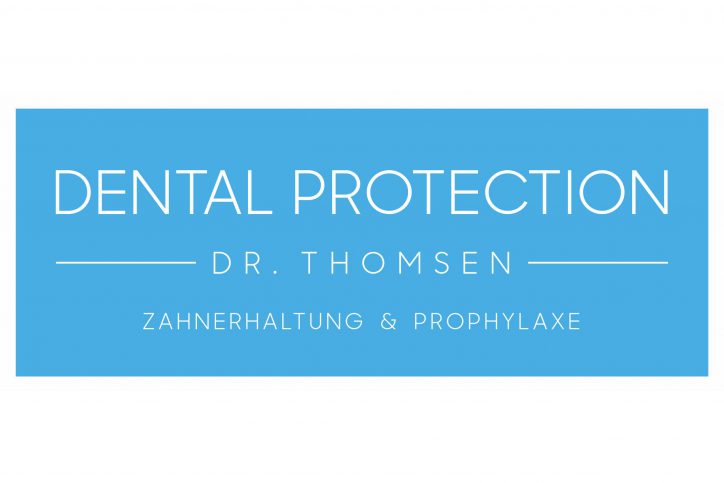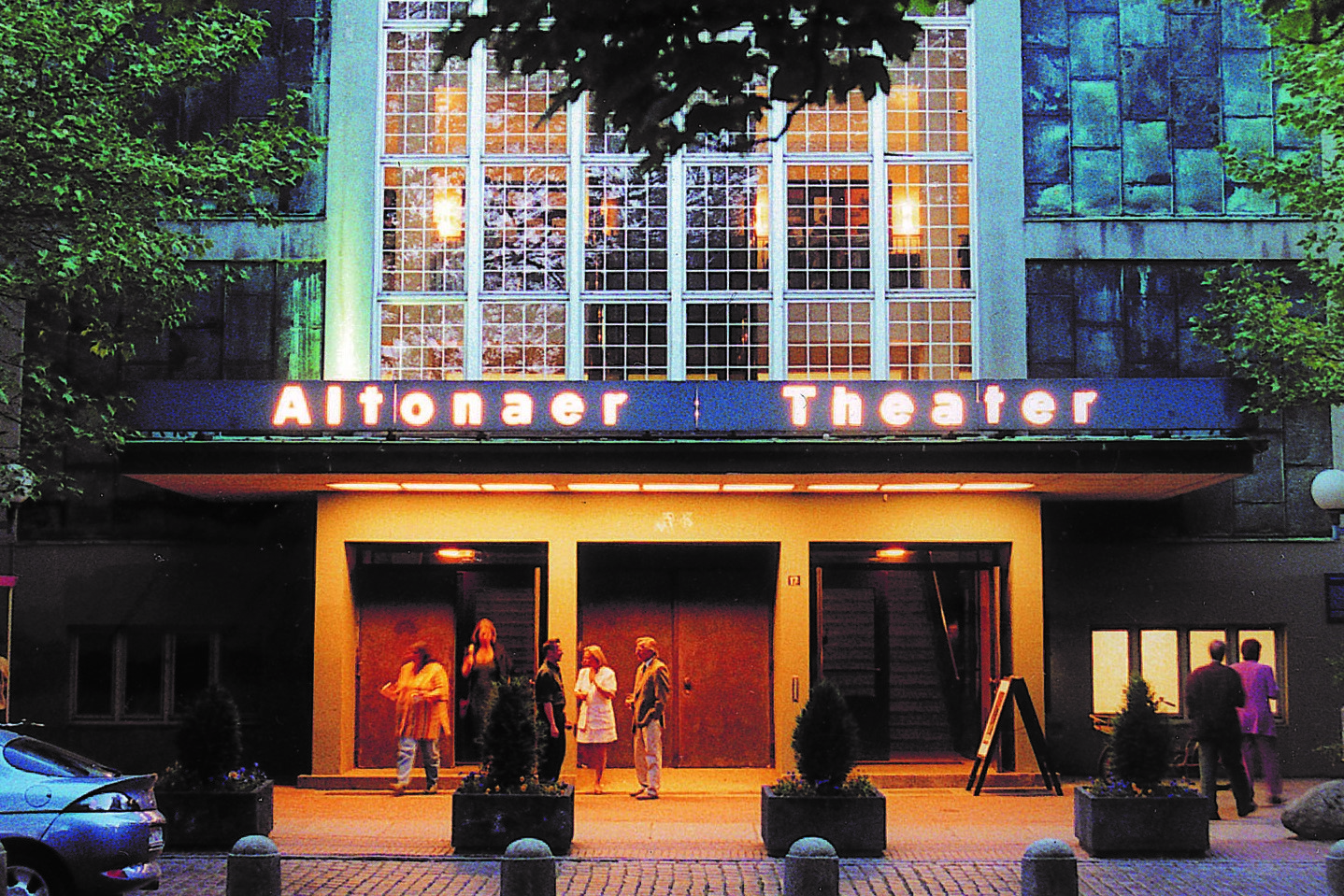MARKK: Wie ein Museum seiner Geschichte begegnet
Das Völkerkundemuseum ist tot. Seine Nachfolge mit der eigenen kolonialen Vergangenheit konfrontiert. Wie räumt das „Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt” mit seiner Geschichte auf? Ein Gespräch mit Direktorin Barbara Plankensteiner.
Von Julia HaasDie Kolonialzeit hat deutsche Museen zur Sammelwut getrieben. Bis 1904 wuchs der Sammlungsbestand des Hamburger Völkerkundemuseums auf 20.000 Objekte – darunter 50 Kunstwerke aus dem Königreich Benin. Von britischen Soldaten geplündert, auf dem europäischen Markt verschachert.
Um der schnell wachsenden Sammlung gerecht zu werden, zog das Museum 1912 in die Rothenbaumchaussee. Knapp 110 Jahre später sitzt es noch immer dort. Von außen hat sich wenig verändert, dafür vieles an den Inhalten.
Seit 2017 leitet Barbara Plankensteiner Eimsbüttels größtes Museum – das „Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt” (MARKK).
Im Gespräch mit Barbara Plankensteiner vom MARKK
Eimsbütteler Nachrichten: Frau Plankensteiner, wie hat sich das MARKK in den letzten Jahrzehnten verändert?
Barbara Plankensteiner: Wer das Museum früher besucht hat, ist in eine konstruierte, außereuropäische Welt eingestiegen. Das Museum war ein begehbarer Schaukasten. Heute konzipieren wir Ausstellungen anders. Wir gehen von den einzelnen Objekten aus, die für die Kunst- und Kulturgeschichten relevant sind, und erzählen, wie Hamburg damit verbunden ist.
Das bedeutet, die Museumsarbeit basiert heute auf anderen Prinzipien?
In den letzten dreißig Jahren hat sich die ethnographische Museumsarbeit radikal verändert. Es geht nicht mehr darum, Kulturen oder Völker auszustellen. Wir beschäftigen uns damit, wie Menschen gesellschaftlich verankert sind, und um globale Kunst- und Kulturgeschichte. Und betrachten das aus verschiedenen Perspektiven, indem wir mit Experten, Wissenschaftlerinnen und zeitgenössischen Kunstschaffenden aus Herkunftsländern zusammenarbeiten.
Dabei greifen wir auch Themen der Gegenwart auf und verbinden sie mit Objekten aus unserem Bestand. Ein Beispiel ist unsere Tirol-Ausstellung. Das Thema haben wir gesetzt, als die Winterurlauber aus Ischgl nach Hamburg zurückkamen und Corona mitgebracht haben. In unserem Bestand haben wir eine interessante historische Tirolsammlung, die wir mit der Hamburger Tirolliebe in Verbindung setzen, diese hinterfragen und in Vergessenheit geratene Geschichten erzählen.
Museen verändern sich – auch ihre Namen
Wann hat die Auseinandersetzung mit Kolonialismus in europäischen Museen begonnen?
Mich begleitet das Thema meine gesamte berufliche Laufbahn über. Ich habe in den 90er-Jahren begonnen, in einem Weltkulturmuseum zu arbeiten. Damals haben wir uns bereits damit beschäftigt – allerdings vorrangig in Fachkreisen. Außerhalb der Museen ist das Thema in den letzten acht bis zehn Jahren aufgekommen.
2017 wurde das Völkerkundemuseum in „Museum am Rothenbaum – Kulturen und Künste der Welt” umbenannt. Warum war das ein wichtiger Schritt?
Der neue Name war ein wichtiges Zeichen nach außen: Völkerkunde gibt es nicht mehr. Wir arbeiten heute anders als früher. Vor sechs Jahren konnten das noch nicht alle nachvollziehen. Inzwischen ist die Debatte um das koloniale Erbe in der Gesellschaft angekommen, und keiner stellt diesen Namenswechsel mehr infrage.
Kolonialzeit für Geschichte des MARKK prägend
In dieser Debatte geht es vor allem darum, die bis heute vorhandenen Auswirkungen der Kolonialzeit aufzuarbeiten. Welche Rolle spielt dabei Hamburg bzw. das MARKK?
Als Hafenstadt hat Hamburg eine wichtige Rolle in der deutschen Kolonialgeschichte gespielt. Von Hamburger Kaufleuten ging der Wunsch aus, dass das Deutsche Reich Kolonien aufbauen sollte. Auch diverse Hamburger Handelsbeziehungen fußten auf kolonialem Handel.
Das MARKK ist damit stark verbunden. Ein Großteil unserer Sammlung ist in dieser Zeit entstanden – auch das Museumsgebäude. Wir arbeiten quasi in einem Kolonialdenkmal. Am Eingang stehen bis heute an den Säulen in goldenen Buchstaben die Namen der großen Handelsunternehmen dieser Zeit. Die Kolonialzeit ist für unsere Museumsgeschichte prägend, deswegen sind wir in der Pflicht, uns damit auseinanderzusetzen und das materielle Vermächtnis für die heutige Gesellschaft aufzuarbeiten.
Wie sieht das aus?
Das umfasst verschiedene Aspekte. Zum Beispiel, dass wir Wissen über außereuropäische Kultur- und Kunstgeschichte vermitteln, die sonst nicht in der Stadt repräsentiert sind. Wir haben wichtige historische Objekte aus vielen Weltreligionen in unserem Bestand, die wir zeigen und erklären wollen. Ein anderer wichtiger Aspekt ist die Provenienzforschung. Dabei geht es darum, herauszufinden, wie unsere Sammlungen entstanden sind und ob sie rechtmäßig erworben wurden. Dafür arbeiten wir mit verschiedenen Partnerinnen der Ursprungsgesellschaften, mit anderen Museen und Wissenschaftlerinnen zusammen.
Raubgut zurückgeben
Viele Museumssammlungen – auch die des MARKK – bestehen zu Teilen aus Raubgut aus der Kolonialzeit. Wie geht das MARKK damit um?
Es gibt klare Fälle von kolonialem Raubgut – zum Beispiel die Benin-Sammlungen. Die Werke sind nach einer kolonialen Invasion der Briten ins heutige Nigeria in die ganze Welt gelangt – auch ins MARKK. Inzwischen hat die Stadt Hamburg einen Vertrag unterschrieben, der regelt, dass der Benin-Bestand nach Nigeria zurückgeht. Für uns steht fest: Werden Objekte zurückgefordert, die unrechtmäßig erworben waren und für die Identität von Gemeinschaften besonders wichtig sind, geben wir sie zurück.
Der Bestand des MARKK beträgt rund 200.000 Objekte. Wie viele sind davon betroffen?
Das können wir noch nicht abschätzen, der Prozess beginnt erst. Es wird Jahre dauern, bis wir einen Überblick haben. Manches wird erst auftauchen, wenn wir mit Wissensträgern aus anderen Ländern zusammenarbeiten.
„Wir wollen nichts verstecken“
Drei Benin-Bronzen wurden bereits an Nigeria übertragen, der Rest folgt, sobald Nigeria dazu bereit ist. Ein Drittel des Bestandes wird als Dauerleihgabe im MARKK bleiben. Warum?
Wir werden damit die Vergangenheit sichtbar machen. In welchem Kontext wir die Benin-Bestände konkret ausstellen, werden wir noch klären. Wichtig ist aber, die Folgen des Kolonialismus in unserer Gesellschaft abzubilden. Dabei geht es viel um Rassismus, Stereotypisierungen und Bilder, die bis heute in den Köpfen verankert sind. Dadurch, dass wir verschiedene Perspektiven in der Ausstellung wiedergeben, wollen wir diese Bilder abbauen.
Transparenz ist für uns sehr wichtig – auch bezüglich unserer eigenen Vergangenheit. Wir wollen nichts verstecken, sondern Themen ansprechen und erklären.
Welche Möglichkeiten bietet dafür der digitale Raum?
Unser Ziel ist es, unsere gesamte Sammlung online zu stellen. Das wird jedoch dauern, weil es viele Ressourcen erfordert. Für den Restitutionsprozess wird es aber entscheidend sein, dass alle Objekte international zugänglich sind.
Restitution
bedeutet, dass Museen Objekte aus ihrem Bestand an Personen, Gemeinschaften oder Institutionen zurückgeben.
Wir haben bereits verschiedene Plattformen aufgebaut, die es ermöglichen, Wissen und Sichtweisen zu unseren Objekten zu teilen. Seit November ist ein digitales Projekt zu den Benin-Werken online. Mit einem internationalen Team haben wir weltweite Sammlungen von Benin-Objekten zusammengeführt, um einen Überblick über den Gesamtbestand zu schaffen.
Bund und Land investieren 123 Millionen Euro in das MARKK. Wie soll sich das Museum mit diesen Mitteln weiter verändern?
In vielen Bereichen ist das MARKK noch ein Museum des 19. Jahrhunderts. Wir wollen das Haus renovieren und sanieren – dazu zählt auch ein barrierefreier Zugang. Außerdem wollen wir die Dauerausstellung neu konzipieren. Unser Plan ist es, ein spannendes Museum für den Bezirk zu schaffen. Einen kulturellen Ort, an dem man sich trifft.
Lokal. Unabhängig. Eimsbüttel+
Du willst wissen, was in Deinem Bezirk wichtig ist? Mit Eimsbüttel+ behältst du den Überblick!

- Exklusiver Online-Content
- Artikel aus unserem Print-Magazin jederzeit online lesen
- Optional: das Magazin alle drei Monate per Post